
Schallenbergs Perspektiven: # 10 Christliche Überlegungen zum assistierten Suizid
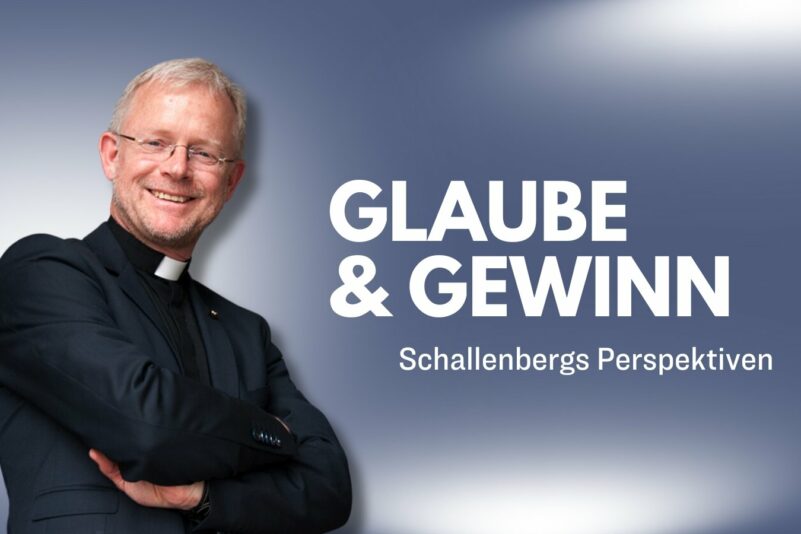
In immer mehr europäischen Ländern gibt es inzwischen Überlegungen zur Ermöglichung eines assistierten Suizids, also einer Beihilfe zur Selbsttötung. Es heißt in den Parlamenten und bei Gerichten: Das entspricht der individuellen Menschenwürde; ein Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben und Freitod. Aus Sicht der christlichen Ethik ist das eine fatale und unheilvolle Entwicklung. Warum?
Christliche Ethik spricht vom vollkommenen Glück als Ziel jedes Menschen und seines Lebens. Christen nennen diese Glückseligkeit „Ewigkeit“, das heißt genauer: Leben in der ewigen Liebe Gottes. Ankommen, wo man hingehört. Ankommen bei dem, der einen erschuf, auf die Lebensreise schickte und der einen erwartet.
Ein Leben in Liebe und gutem Begehren
Lebensqualität bemisst sich an diesem Anspruch: Jeder möchte in der Quantität einer Lebenslänge eine Qualität von Lebenserfahrung machen. Erfahrung von Liebe und Zuneigung und von Begehren und Begehrtwerden. Gott begehrt uns unendlich und ewig, sagt das Christentum und fordert auf zu einem dementsprechenden Leben in Liebe und gutem Begehren.
Ein menschliches Leben samt seiner Lebensgeschichte ist dementsprechend dann gut und geglückt, wenn es jetzt schon, in der flüchtigen und vergänglichen Zeit, Antwort gibt auf die ewige und unvergängliche Liebe Gottes. Immer ist dies eine Antwort im Fragment und in Bruchstücken, unvollkommen und begrenzt durch eigenen und anderen Tod und doch immer ein Versuch der Antwort auf die alles entscheidende Frage Gottes „Adam, wo bist Du?“ im ersten Buch der Bibel.
Was Gott nach biblischer Überlieferung einst dem Adam als Bild des Menschen schlechthin zurief, das will der christliche Glaube jedem Menschen als tröstliche Frage zurufen: Wo bist Du? Im Raum der Liebe, der Achtung, der Anerkennung? Auch und gerade in Alter und Gebrechlichkeit, auch und gerade am Ende des zeitlichen und irdischen Lebens?
Gott wird aufgerufen als Bürge einer unveräußerlichen Würde jedes einzelnen Menschenlebens: Gott will das Leben jedes Menschen als unbedingt notwendige Vorbereitung seiner Ewigkeit. Und die christlichen Kirchen mit ihren Einrichtungen der Altenhilfe, der Pflege und der Hospize wollen diesen Willen und diese Liebe Gottes jedem Menschen möglichst hautnah vor Augen führen. Auch und gerade in sicherer Erwartung des leider sehr ungewohnten und daher erschreckenden Sterbens.
[etd-related posts=“3875500″]
Das eigene Leben als Geschenk und Zumutung Gottes
Der christliche Glaube an einen liebenden Gott meint zuerst die unverbrüchliche und unbezweifelbare Notwendigkeit jedes menschlichen Lebens, unabhängig von Krankheit, Einschränkung oder Schwäche. Dies nennt die christliche Theologie die Annahme des eigenen Lebens. Leitend ist die Überzeugung, der Mensch könne sich aus sich selbst heraus, also in isolierter Autonomie, nicht verstehen. Gemeint ist die Antwort auf die Frage: Wozu ist es gut, dass ich da bin? Kann ich die eigene Existenz als absolut sinnvoll annehmen? Diese Annahme der eigenen leibhaften und konkreten Existenz als Geschenk und Zumutung Gottes ist der erste Schritt auf dem Weg der durchaus ungewohnten Aufgabe der Lebensbewältigung.
Christlich zugespitzt: Es geht um die lebenslange Aufgabe, dem Ruf und der Berufung Gottes Folge zu leisten, das eigene Lebenshaus zu bewohnen und zu gestalten, im Vertrauen auf den unbedingten Willen Gottes zu diesem Lebenshaus und dieser Lebensgeschichte. Der Glaube an Gott soll schützen vor einer wachsenden Verzweiflung über die Absurdität des eigenen Lebens.
[etd-related posts=“4878535″]
Durch alles Scheitern hindurch einen unzerstörbaren Sinn bewahren
Der große dänische Philosoph Søren Kierkegaard bezeichnete im 19. Jahrhundert eine solche im Herzen eines Menschen wuchernde Verzweiflung als „Krankheit zum Tode“, eine Krankheit, die zum inneren Tod eines Menschen führt, längst bevor der äußere, physische Tod festgestellt wurde.
Christentum will solcher inneren Verzweiflung vorbeugen, zumindest sie heilen, aufhalten, herauszögern. Jeder Mensch darf und soll sich als wunderbare fleischgewordene Idee Gottes empfinden, kurz: als endgültiges Ebenbild Gottes. Darin liegt Gabe und Aufgabe zugleich: Durch Gelassenheit, Tapferkeit, Versöhntheit mit sich selbst und das von anderen Menschen zugesprochene Vertrauen, die eigene Lebensgeschichte könne durch alles Scheitern hindurch einen unzerstörbaren Sinn bewahren. Erst so wird am Ende ein versöhntes Sterben und ein Loslassen des irdischen Lebens ermöglicht. Gott und die Würde des Menschen sind in dieser Sicht zwei Seiten einer Medaille.
Gabe und Vergebung hängen nicht nur sprachlich eng zusammen. Im Blick auf das Leben des Menschen heißt das aus christlicher Sicht: Das biologische Leben eines Menschen wird als Gabe und Geschenk Gottes betrachtet und damit als Aufgabe, vielleicht sogar als Pflicht? Dann hätte das Christentum und hätten die Kirchen in einem säkularen Staat die Pflicht, in ihren karitativen Einrichtungen solche „Pflicht“ als Aufgabe am Lebensende möglich zu machen, mehr noch: als attraktiv erscheinen zu lassen, leben zu dürfen, auch wenn es ungeheuer anstrengend und manches Mal schier unerträglich ist.
[etd-related posts=“3972070,3167790″]
Wird mein Tod keine unerträgliche Lücke reißen?
Ist denn das Leben des Menschen nicht weit mehr als ein bloßes Ding, am Lebensende pathologisiert und hospitalisiert? Und ist nicht das Leben des Menschen deswegen der Verfügung des Menschen entzogen? Denn wer könnte abschließend autonom beurteilen, dass sein Tod keine unerträgliche Lücke reißen würde? Die Verfassung immerhin spricht in Artikel 1 GG von der unantastbaren Würde des Menschen und meint damit – im Anschluss an Immanuel Kant – auch eine Unantastbarkeit durch den Menschen selbst. Denn jeder Mensch ist sich selbst verpflichtet und darf davon ausgehen: Die Mitmenschen freuen sich über mein Dasein.
So bleibt zuletzt eine doppelte Frage: Soll und darf die Verfassungsordnung mit dem markanten Artikel 1 GG bestimmte Fragen der Autonomie des Individuums (und des Patienten) entziehen, oder aber ist es der treue und bisweilen grausame Notar alles Denkbaren, auch der selbstbestimmten Abschaffung des Menschen?
Letztere Interpretation legt zumindest das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 zur Erlaubtheit des assistierten Suizids nah; seitdem kreist die Diskussion auch und gerade um den Begriff und die Idee der menschlichen Autonomie. Das genannte Urteil sieht eine solche unbehinderte individuelle Autonomie als Kern der Menschenwürde.
[etd-related posts=“4995834,4964776″]
Sterbebegleitung statt Sterbehilfe
Autonomie in kantischer Tradition jedenfalls meint nicht inhaltsleere Selbstbestimmung, sondern Selbstgesetzgebung im Sinne der Selbstzwecklichkeit der eigenen Person, die nicht Mittel zum Zweck eigenen Wohlbefindens werden darf.
Reicht aber dafür (und zur weiteren Bewältigung des dann zugemuteten Lebens) eine säkulare Begründung? Braucht es nicht Gott (gegen das Absurde) und die lebendige Vorstellung seines unbedingten (göttlichen) Willens zum eigenen Leben, um dauerhaft leben zu wollen?
Hier öffnet sich dann nicht nur das weite und fruchtbare Feld der Palliativmedizin mit der Unterscheidung von Therapiebegrenzung angesichts ungünstiger medizinischer Prognose und der Änderung des Therapiezieles, sondern auch das Feld christlicher Caritas und Diakonie mit ihren Einrichtungen der Pflege und der Sterbebegleitung. Die Linderung der Schmerzen, nicht die Herbeiführung des Todes, ist das ethische, medizinische und christliche Gebot am Ende eines menschlichen Lebens. Daraus aber folgt konsequent eine Ablehnung der Suizidassistenz.
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.



vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion