
EU-Datengesetz greift ab 12. September – was sich jetzt ändert

In Kürze:
- Ab 12. September 2025 findet das EU-Datengesetz Anwendung.
- Neben möglichen Vorteilen für Verbraucher gibt es auch kritische Betrachtungen.
- Es ist vor allem eine große Belastung für die Hersteller von sogenannten smarten Haushalts- und Alltagsgeräten.
Kühlschrank, Fernseher, Transportmittel: Sind bald alle unsere Haushaltsgeräte miteinander vernetzt? Die Europäische Union will „den digitalen Wandel“ in unseren vier Wänden vorantreiben.
Dazu findet ab Freitag, 12. September, das EU-Datengesetz („EU-Data-Act“) Anwendung. Die europäische Behörde hat es bereits Anfang 2024 beschlossen. Die EU-Verordnung soll den Verbrauchern mehr Rechte an den Daten einräumen, welche die eigenen digitalen Haushaltsgeräte bei deren Verwendung sammeln.
Das Gesetz verlangt jetzt vor allem von den Herstellern mehr Klarheit. Sie müssen demnach offenlegen, welche Informationen das jeweilige Gerät erhebt – und wie der Nutzer darauf zugreifen kann. Das soll dem Verbraucher erleichtern, seine Gerätedaten einzusehen. Bei Bedarf soll er sie an andere Dienste weitergeben können, etwa zu Reparaturzwecken. Doch es gibt auch Kritik an dieser Digitalisierung sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung.
Für welche Geräte gilt das Gesetz?
Die Regeln gelten für alle sogenannten vernetzten Geräte. Diese besitzen entweder eine Internetverbindung oder eine kabelgebundene Datenübertragung. Viele Hersteller bieten solche „smarten“ Geräte bereits seit einiger Zeit an.
Auch Geräte, auf die der Nutzer per Funk oder mit einer App zugreifen kann, fallen unter das neue Datengesetz. Das kann die Kaffeemaschine, die Waschmaschine, der Backofen oder die Heizung sein. Betroffen sind neben Neugeräten auch bereits erworbene Geräte, die die Verbraucher weiter nutzen.
Übrigens: Wer sein „smartes“ Gerät weiterverkauft, muss dem neuen Besitzer erklären, wie er an die Daten des Geräts kommt. Das EU-Datengesetz unterscheidet nicht zwischen Erstbesitz und Secondhand.
[etd-related posts=“4839326,4820017″]
Welche Daten werden gesammelt?
Welche Daten konkret unter die Verordnung fallen, ist dort nur allgemein gehalten. Zu den betroffenen Daten gehört demnach „jede digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen“.
Das können auch Videos, Bilder oder Tonaufnahmen sein, die ein Gerät gemacht hat. Entscheidend ist also eher, ob das betroffene Gerät Daten über seine Nutzung, Leistung oder Umwelt generiert oder sammelt – und weniger, wie es das tut.
Die Liste betroffener Branchen und Gesellschaftsbereiche ist also umfassend: Mobiltelefone, Smartwatches, moderne Küchengeräte, Klimaanlagen oder Autos sind ebenso betroffen wie industrielle Maschinen oder Flugzeuge.
Unternehmen kaum vorbereitet
Der IT-Verband Bitkom fand heraus, dass viele Unternehmen noch gar nicht auf das EU-Datengesetz vorbereitet sind. So haben im Mai 2025 nur 1 Prozent von 605 befragten Unternehmen in Deutschland die Vorgaben vollständig umgesetzt, weitere 4 Prozent zumindest teilweise. 10 Prozent haben gerade erst mit der Umsetzung begonnen, 30 Prozent haben noch nicht damit angefangen.
Eine Mehrheit von 52 Prozent glaubt, dass sie vom EU-Data-Act gar nicht betroffen ist. Aber: „Der Data-Act betrifft so gut wie jedes Unternehmen, aber die meisten haben sich damit noch gar nicht ernsthaft befasst“, sagte Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.
Er warnte gleichzeitig vor einer möglichen weiteren Bremse für Unternehmen: „Beim Data-Act darf sich das Drama der Datenschutz-Grundverordnung nicht wiederholen. Die DS-GVO ist durch jahrelange Unsicherheiten und Umsetzungsschwierigkeiten zu einem echten Innovationshemmer geworden. Das Management muss jetzt aufwachen und die Politik muss besser unterstützen.“
[etd-related posts=“5237131,5234970″]
Datengesetz schwierig umzusetzen
Hinzu kommt, dass die neue Datenverordnung eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen bedeutet, die etwa den Wechsel von Cloud-Anbietern erleichtern sollen. Zugleich verlangt das Gesetz aber auch Vorgaben für Vertragsklauseln rund um Daten und gibt vor allem Nutzern sowie Dritten Rechte an Daten der vernetzten Geräte.
Die Umsetzung des Datengesetzes bedeute für die meisten Unternehmen laut Bitkom einen hohen Aufwand. Demnach sprechen 32 Prozent der befragten Unternehmen von einem sehr hohen Umsetzungsaufwand, 34 Prozent von einem eher hohen. 75 Prozent dieser Unternehmen hätten beklagt, dass durch die Umstellung auf das EU-Datengesetz die Zeit für neue Innovationen fehle.
Ab September 2026 sieht das EU-Datengesetz unter anderem vor, dass Hersteller ihre neuen Produkte mit einfachen Schnittstellen für den Datenzugang ihrer Nutzer auf den Markt bringen. Sie müssen die neuen Rechte ihrer Kunden also bei der Entwicklung bereits mitbedenken.
[etd-related posts=“5235701,5234216″]
Unternehmen überfordert
Ganze 90 Prozent der Unternehmen fühlten sich von den neuen Gesetzen und Anforderungen überfordert. Ebenfalls 90 Prozent fordern mehr Beratung durch öffentliche Stellen bei der Umsetzung des Data-Acts.
„Nicht nur die Unternehmen, auch die Politik muss beim Data-Act ihre Hausaufgaben machen. Wer Regulierung beschließt, muss auch die Betroffenen ausreichend informieren und unterstützen“, so Wintergerst. Er kritisiert die vergangene Bundesregierung dafür, dass es ihr „in eineinhalb Jahren nicht einmal gelungen ist, jene Behörde zu benennen, die die Umsetzung des Data Act beaufsichtigen soll“.
Er forderte die neue Regierung auf, dies „umgehend“ nachzuholen. „Daten sind in vielen Bereichen entscheidend für den Geschäftserfolg, ob bei Training und Nutzung von KI, in der Medizintechnik oder in der Automobilbranche.“
Eine ähnliche Kritik äußerte auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). In Deutschland herrsche wegen der EU-Verordnung noch viel Unsicherheit. Eine funktionierende Datenwirtschaft sei zentral für erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle, teilte BDI-Co-Geschäftsführerin Iris Plöger mit. „Der EU-Gesetzgeber greift jedoch übermäßig in die Vertragsautonomie der Industrie ein“, sagte sie.
Welche Vorteile haben die Nutzer?
Oft haben sich Hersteller bisher Nutzungsrechte an allen anfallenden Daten selbst eingeräumt. Nun sollen sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen mehr Kontrolle über die eigenen Daten bekommen. Sie sollen künftig auf diese Daten zugreifen, sie löschen oder auch an Dritte weitergeben können.
Besonders Letzteres ist mit der Hoffnung verbunden, dass Reparaturen oder andere Dienstleistungen für Nutzer günstiger und einfacher werden. Beispielsweise könnte sich ein Autobesitzer künftig dafür entscheiden, bestimmte Daten mit seiner Versicherung zu teilen. In der Theorie könnte ein vorbildliches Fahrverhalten vielleicht zu einer geringeren Versicherungsprämie führen. Gleichzeitig könnte Fehlverhalten diese aber auch verteuern.
[etd-related posts=“4949563,4915567″]
Laut der Europäischen Verbraucherschutzorganisation Beuc gibt es aber zu viele Ausnahmeregelungen, die diese Möglichkeiten in der Praxis erschweren. Beuc-Geschäftsführer Agustín Reyna bezeichnete das Gesetz daher als eine „verpasste Chance“.
Wie gelangen Nutzer an die Daten?
Hier gibt die EU-Verordnung den Anbietern zwei Möglichkeiten: direkten oder indirekten Zugang. Wo möglich, sollen Nutzer ohne Weiteres selbst auf die Daten zugreifen können. Wie das geht, darüber müssen die Anbieter und Hersteller bei Erwerb des Produkts informieren.
Sollte ein direkter Zugang nicht möglich oder vom Hersteller nicht erwünscht sein, so soll die Verordnung nach einer einfachen Anfrage, etwa auf einem entsprechenden Webportal, reichen. Ohne große Hürden soll dann eine Antwort mit den entsprechenden Daten folgen.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)








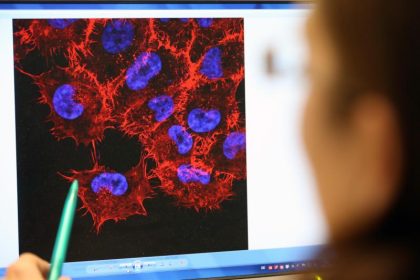

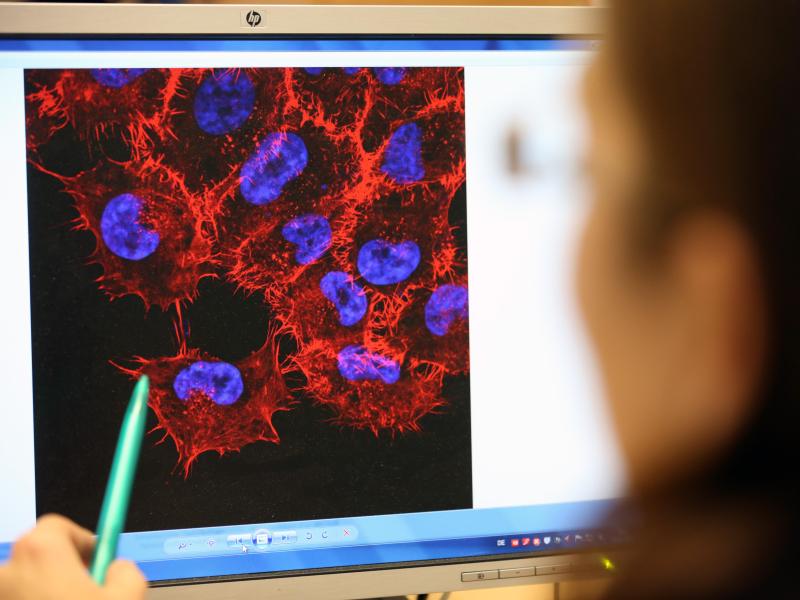



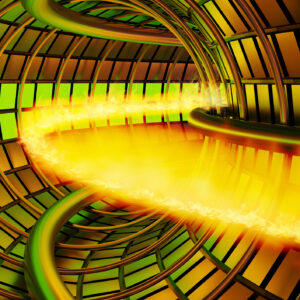










vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion