
Italien überrascht die Finanzmärkte: Ist Melonis Sparkurs das Erfolgsrezept?

In Kürze:
- Italiens Bonität steigt auf BBB+ mit stabilem Ausblick.
- Haushalt und Wirtschaft erholen sich: Das Defizit sinkt, die Staatsschulden stabilisieren sich und Italien erzielt wieder Exportüberschüsse.
- Meloni zwischen Verdienst und Glück: Die Verbesserung gilt teils als Bestätigung ihrer Politik, teils als Ergebnis günstiger Rahmenbedingungen wie Pandemieaufschwung, Energiepreisentlastung und EU-Investitionshilfen.
Die jüngste Entscheidung von Fitch Ratings hat für Aufsehen gesorgt: In der vergangenen Woche hob die US-amerikanische Agentur die Kreditwürdigkeit des Landes erneut an. Italiens langfristiges Ausfallrisiko in Fremdwährung („Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating“, IDR) stieg von BBB auf BBB+, der Ausblick bleibt stabil. Auch die kurzfristige Bonität wurde von F2 auf F1 angehoben. Zudem erhöhte Fitch die sogenannte „Country Ceiling“ auf AA+.
„Wir haben Italien wieder auf den richtigen Weg gebracht“, erklärte Finanzminister Giancarlo Giorgetti noch am Abend der Entscheidung. „Es ist ein klares Zeichen des Vertrauens der internationalen Märkte: Politische Stabilität, glaubwürdige Wirtschaftspolitik und Unterstützung für diejenigen, die Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen, tragen Früchte“, wird Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der Nachrichtenagentur „Reuters“ zitiert.
Damit erhält Ministerpräsidentin Meloni Rückenwind. Ihre Regierung wirbt seit Amtsantritt im Herbst 2022 mit Haushaltsdisziplin und Reformen. Doch bestätigt die ökonomische Realität tatsächlich ihre Politik?
[etd-related posts=“5257541″]
Die Ratingagentur Fitch bescheinigt Italien eine neue „Erfolgsbilanz fiskalischer Disziplin“. Gemeint ist damit, dass der Staat seine Finanzen zunehmend im Griff hat: Das Haushaltsdefizit – also die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben – sinkt schneller als erwartet. Für 2025 rechnet Fitch mit einem Fehlbetrag von 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, etwas weniger als die Regierung selbst vorsieht. Bis 2027 soll das Defizit auf 2,6 Prozent sinken, bis 2029 sogar unter 2 Prozent.
Möglich wird dies nach Einschätzung der Analysten durch robuste Steuereinnahmen, eine stabile Beschäftigungslage, bessere Steuermoral und eine strikte Kontrolle der Staatsausgaben. Damit sei Italien auf einem guten Weg, die neuen EU-Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung einzuhalten – ein Vertrauenssignal für Investoren und Finanzmärkte.
Schon in den vergangenen Jahren konnte Italien seine Haushaltslage deutlich verbessern. Während das Defizit 2022 noch bei 7,2 Prozent der Wirtschaftsleistung lag, sank es 2023 bereits auf 3,4 Prozent. Fitch führt diese Entwicklung auf eine Politik strikter Ausgabendisziplin zurück. Unter dem Schlagwort „Spending Restraint“ erwarten die Analysten, dass die Staatsausgaben mittelfristig auf rund 49 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückgeführt werden – ein Niveau, das zuletzt vor der Corona-Pandemie erreicht wurde.
Unter „Spending Restraint“ versteht Fitch eine Politik strikter Ausgabenkontrolle, bei der die Staatsausgaben bewusst gebremst werden, um die Haushaltslage dauerhaft zu stabilisieren.
Schuldenstand: Stabilisierung nach raschem Rückgang
Besonders hebt Fitch die Entwicklung der Staatsschulden hervor. Italien hatte während der Pandemie einen historischen Anstieg verzeichnet, doch zwischen 2020 und 2024 sank die Schuldenquote um mehr als 20 Prozentpunkte und erreichte wieder das Vorkrisenniveau. Im vergangenen Jahr lag sie bei etwa 135,3 Prozent des BIP. Für dieses Jahr, so die aktuelle Schätzung, wird die Schuldenquote leicht auf rund 137,3 Prozent steigen. Unter anderem wegen der Kosten des Bauförderprogramms „Superbonus“.
[etd-related posts=“5136006″]
Der italienische „Superbonus“ ist ein staatliches Förderprogramm, das Hausbesitzer dabei unterstützt, ihre Gebäude energieeffizienter oder erdbebensicherer zu machen. Wer etwa die Wärmedämmung verbessert oder eine moderne Heizanlage einbaut, kann einen großen Teil der Kosten über Steuervergünstigungen zurückbekommen. In den ersten Jahren lag die Förderung sogar bei 110 Prozent der Investition. Das heißt: Der Staat zahlte mehr zurück, als tatsächlich ausgegeben wurde. Inzwischen wurde der Bonus schrittweise gesenkt: 2024 liegt er bei 70 Prozent, 2025 bei 65 Prozent. Ursprünglich konnten Eigentümer den Bonus auch direkt an Baufirmen oder Banken weitergeben, doch diese Möglichkeit ist für neue Projekte inzwischen eingeschränkt. Ziel des Programms bleibt, private Sanierungen anzukurbeln und den Gebäudebestand klimafreundlicher zu machen.
Italiens Verschuldung bleibt allerdings hoch. Im Vergleich zu anderen Ländern mit einer ähnlichen Bonitätsbewertung ist Italiens Schuldenstand nach wie vor hoch – der Durchschnitt liegt bei 57,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Dennoch sieht Fitch die Risiken für die Staatsfinanzen als beherrschbar an. Entscheidend dafür sind die lange Laufzeit italienischer Anleihen von rund sieben Jahren, eine breite Basis an Investoren und die Absicherung durch die Europäische Zentralbank.
Ein weiterer Treiber für die Bonitätsverbesserung liegt in der außenwirtschaftlichen Lage. Italien erwirtschaftete 2024 einen Leistungsbilanzüberschuss von 1,1 Prozent des BIP, der auch in den Folgejahren Bestand haben soll. Besonders die Energieimporte haben sich durch Diversifizierung verbilligt. Gleichzeitig profitiert das Land von einer robusten Exportbasis und besserer Preiswettbewerbsfähigkeit.
Italien hat seine Außenwirtschaftsbilanz im Frühjahr 2024, laut Zahlen der Banca d’Italia deutlich verbessert. In den zwölf Monaten bis Mai letzten Jahres erzielte das Land einen Leistungsbilanzüberschuss von rund 30 Milliarden Euro – das entspricht 1,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte Italien noch ein deutliches Defizit. Der Hauptgrund für die positive Entwicklung ist der starke Exportüberschuss bei Waren, während auch die Dienstleistungen etwas besser abschnitten. Zwar rutschte der Einkommenssaldo leicht ins Minus, doch das wurde durch den Exportboom mehr als ausgeglichen.
[etd-related posts=“5251023″]
Auch beim Nettoauslandsvermögen – also dem Unterschied zwischen italienischen Anlagen im Ausland und ausländischen Investitionen in Italien – zeigt sich ein Plus: Ende März 2024 besaß Italien Guthaben von rund 165 Milliarden Euro, knapp 8 Prozent des BIP. Das ist mehr als zu Jahresbeginn. Neben den Exportüberschüssen trugen auch Bewertungsgewinne, etwa durch den gestiegenen Goldpreis, zu dieser Verbesserung bei.
Auf dem Finanzkonto stiegen im Mai sowohl die Vermögenswerte italienischer Investoren im Ausland als auch die Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland. Italienische Anleger investierten stärker in Anleihen, Direktbeteiligungen und sonstige Finanzprodukte. Gleichzeitig flossen mehr ausländische Mittel in italienische Wertpapiere – vordergründig in Staatsanleihen. Zwar gingen die Direktinvestitionen, so die Angaben der Banca d’Italia, im Land etwas zurück, doch insgesamt überwogen die Kapitalzuflüsse.
Wachstumsdynamik: Über Deutschland hinausgewachsen
Die wirtschaftliche Entwicklung untermauert den positiven Trend. Im vergangenen Jahr überraschte Italien mit einem BIP-Wachstum von 0,7 Prozent, während Deutschland ein Minus von 0,5 Prozent hinnehmen musste.
Für 2025 erwartet Fitch für Italien ein Plus von 0,6 Prozent. Für die Jahre 2026 und 2027 jeweils etwa 0,8 Prozent.
Wachstumsquellen sind vor allem Investitionen, unterstützt durch Mittel aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm „Next Generation EU“, das Italien mit 191,6 Milliarden Euro am stärksten fördert. Risiken bestehen allerdings in der Umsetzung, da bis 2026 zahlreiche Projekte abgeschlossen sein müssen.
[etd-related posts=“5237131″]
Der italienische Arbeitsmarkt zeigt sich robust: Die Arbeitslosenquote liegt inzwischen unter dem Eurozonendurchschnitt, die Erwerbsbeteiligung steigt. Dies stützt den Konsum und die Steuereinnahmen. Auch der Bankensektor wird von Fitch als stabil bewertet: Die Quote notleidender Kredite sank 2024 auf 2,8 Prozent, den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Kapitalausstattung und Liquidität gelten als solide, die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen nimmt wieder zu.
Politische Stabilität und alternde Bevölkerung
Ein zentrales Argument für die Aufwertung ist die politische Stabilität. Italien, lange für Regierungswechsel im Jahrestakt bekannt, wird seit 2022 von der Rechtskoalition unter Giorgia Meloni geführt. Trotz Spannungen mit Brüssel über Migrations- und Energiefragen gilt ihre Regierung als durchsetzungsfähig.
Fitch verweist auf Italiens gute Werte bei den Governance-Indikatoren der Weltbank: Rechtsstaatlichkeit, Institutionsqualität und geringe Korruption liegen über dem Schnitt vergleichbarer Länder. Dies spiegele sich auch in den ESG-Bewertungen wider.
Trotz der Verbesserungen bleibt Italien strukturell anfällig. Fitch spricht von „low growth potential“. Demografische Trends – eine alternde Bevölkerung und geringe Geburtenraten – drücken das langfristige Potenzialwachstum. Die Ratingagentur rechnet lediglich mit 0,8 Prozent Wachstum im Schnitt bis 2027.
[etd-related posts=“4999635″]
Zudem bleibt die Schuldenquote trotz Rückgangs sehr hoch, sodass negative Marktstimmungen schnell auf Italien durchschlagen könnten.
Meloni sieht sich bestätigt
Die derzeitige Stabilität Italiens ist also das Ergebnis sowohl gezielter politischer Steuerung als auch günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.
Mit der Hochstufung durch Fitch gewinnt Italien international an Reputation. Die Kombination aus fiskalischer Konsolidierung, stabilem Wachstum und politischer Berechenbarkeit hebt das Land von seinen europäischen Nachbarn ab – insbesondere von Frankreich, das 2024 herabgestuft wurde, und von Deutschland, dessen Konjunktur stagniert.
Ob diese Entwicklung langfristig trägt, hängt davon ab, ob Italien seine Reformagenda fortsetzt und die strukturellen Schwächen – geringe Produktivität, alternde Gesellschaft, hohe Schulden – überwindet. Für Giorgia Meloni bedeutet die Entscheidung von Fitch in jedem Fall einen politischen Erfolg: Zumindest kurzfristig scheint die wirtschaftliche Realität ihren Kurs zu bestätigen.








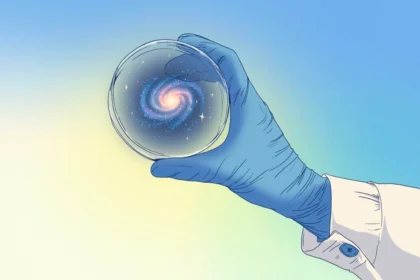







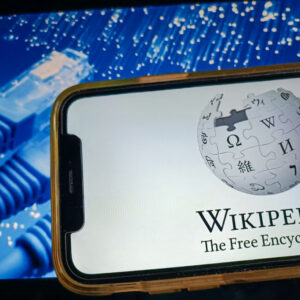








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion