
Steuern fremde Mächte Europas Straßenproteste und Debatten?

Nach der Ermordung von Charlie Kirk haben Cybersicherheitsexperten einen Anstieg von Social-Media-Beiträgen festgestellt, die nicht nur Falschinformationen über den Mord verbreiten, sondern offenbar auch darauf abzielen, Social-Media-Nutzer in einer ohnehin schon politisch angespannten Lage weiterhin zu empören.
Dies meldete zum Beispiel am 17. September der private amerikanische Nachrichtensender „ABC News“. Tags darauf folgte der US-Privatsender NPR mit einem ähnlichen Onlinebeitrag: „Ausländische Influencer geben ihr Bestes, um die Ermordung von Charlie Kirk zu verdrehen“, lautete die Überschrift.
„Wir haben Bots [Computerprogramme], die menschliches Verhalten imitieren, aus Russland, China und der ganzen Welt, die versuchen, Fehlinformationen zu verbreiten und zu Gewalt anzustacheln“, zitierte NPR den Gouverneur von Utah, Spencer Cox (Republikaner), der sich dazu wenig später nach der Ermordung Kirks vor der Presse geäußert hatte.
[etd-related posts=“5244543″]
Internet macht „süchtig nach Empörung“
Cox warnte wiederholt vor den Gefahren der sozialen Medien, die er als „Krebsgeschwür unserer Gesellschaft“ bezeichnete. „Ich kann gar nicht genug betonen, welchen Schaden soziale Medien und das Internet uns allen zufügen. Diese Dopaminkicks, diese Unternehmen – mit einer Marktkapitalisierung von Billionen Dollar, die mächtigsten Unternehmen in der Geschichte der Welt – haben herausgefunden, wie sie unser Gehirn hacken, uns süchtig nach Empörung machen […] und uns dazu bringen, einander zu hassen“, sagte Cox am 14. September in der NBC-Sendung „Meet the Press“.
Es ist nicht das erste Mal, dass Cox vor den Gefahren von Social Media warnt. Im Juni dieses Jahres hatte er eine Klage gegen Snapchat, Meta und TikTok angestrengt. In diesem Fall geht es um den Einfluss von sozialen Medien auf Kinder und Jugendliche.
Gewalt soll auf Europa übergreifen
Die amerikanischen Medien berufen sich bei der Warnung vor russischer Einflussnahme auf das Internet unter anderem auf Cyberanalysten des privaten Center for Internet Security (CIS). Das Beobachtungszentrum glaubt festgestellt zu haben, dass es für die wahrgenommene Zunahme politischer Gewalt in den USA „deutliche Anzeichen ausländischer Manipulation“ gebe.
Viele Onlinebeiträge ließen sich CIS zufolge „auf von Russland unterstützte Gruppen zurückführen, darunter die bekannte russlandfreundliche Einflusskampagne ‚Operation Overload‘“.
Und weiter: „Ein Großteil der Inhalte schien darauf abzuzielen, Konservative und LGBTQ+-Zielgruppen anzusprechen, wobei gefälschte Nachrichtenberichte, erfundene Zitate von Prominenten und irreführende Bilder verwendet wurden, um politische Empörung zu schüren“, so CIS auf seiner Website.
So habe es etwa ein Video gegeben, das den Anschein erweckte, als stamme es vom französischen TV-Sender „France24“. Darin sei fälschlicherweise behauptet worden, ein französischer Beamter habe LGBTQ+-Amerikaner aufgefordert, nach Frankreich zu ziehen, um „Verfolgung zu vermeiden“.
[etd-related posts=“5249662″]
Ein anderer Beitrag behauptete, das englische Staatsfernsehen BBC habe gewarnt, dass Angriffe auf konservative Politiker von den USA auch „auf Europa übergreifen würden“. Weiterhin habe es gefälschte Aussagen von Schauspielern und von US-Präsident Donald Trump gegeben. Auf diese Weise sollen Nutzer aus verschiedenen politischen Lagern gegeneinander aufgebracht werden, heißt es in einem ABC-Beitrag.
„Ihr Ziel ist es nicht nur, die Menschen dazu zu bringen, die Inhalte zu lesen und anzuhören, sondern auch, darauf zu reagieren“, zitiert „ABC News“ John Cohen, einen ehemaligen Mitarbeiter des US-Heimatschutzministeriums. „Und in unserer aktuellen Bedrohungslage ist das gefährlich.“
Zu Protesten in London und Gewalt in Den Haag
Trifft das bereits auch auf Europa zu? In den vergangenen Tagen war es zu Großdemonstrationen gegen die aktuelle Asylpolitik in London und in Den Haag gekommen. Dabei kam es in den Niederlanden zu schweren Gewalttaten und Ausschreitungen. Könnten auch diese von einer ausländischen Macht zumindest über soziale Medien „beeinflusst“ worden sein?
Vordergründig werden in den Medien die jeweiligen Veranstalter genannt: Für die Londoner Großdemo mit 150.000 Teilnehmern, bei der es auch stellenweise zu Ausschreitungen kam, wird der mehrfach zu Gefängnisstrafen verurteilte Tommy Robinson genannt. Er heißt eigentlich Stephen Yaxley, stammt aus der rechten Fußball-Hooligan-Szene und agitiert hauptsächlich gegen muslimische Einwanderer nach Großbritannien.
[etd-related posts=“5245834″]
Bei Facebook und Instagram ist er dauerhaft gesperrt, bei X und YouTube nicht. Die von ihm organisierte Protestaktion wurde zwar unter anderem mittels sozialer Medien gesteuert, eine ausländische Einflussnahme lässt sich jedoch nicht nachweisen. Die Demonstration blieb weit überwiegend friedlich.
Bei einer Anti-Einwanderungsdemonstration in Den Haag am 20. September kam es jedoch zu schweren Gewalttaten. Demonstranten setzten ein Polizeiauto in Brand und zertrümmerten die Fenster des Büros der politisch linksgerichteten Partei D66 im Stadtzentrum, wie niederländische Medien berichteten.
Des Weiteren sei die Autobahn A12 zeitweilig blockiert gewesen und Polizisten seien angegriffen worden. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Demonstration wurde laut „Dutch News“ von einer Social-Media-Kommentatorin namens Els Rechts organisiert, um die Regierung zu strengeren Einwanderungs- und Asylkontrollen zu bringen.
Sie soll gegenüber dem lokalen Fernsehsender „Omroep West“ ihr Bedauern über die Gewaltausschreitungen zum Ausdruck gebracht haben: Sie hätte die Protestaktion „niemals organisiert“, wenn sie gewusst hätte, dass es zu Gewalt kommen würde.
[etd-related posts=“5250111″]
Bots und Deepfakes
Stellt sich die Frage: Wie können Social-Media-Nutzer erkennen, ob sie Teil einer echten politischen Debatte sind – oder Teil einer gesteuerten Kampagne?
Heutzutage ist es mittels sozialer Medien am einfachsten und am schnellsten, Desinformation zu verbreiten und eine hohe Anzahl an Menschen zu erreichen. Dies liegt an den Funktionsweisen und Algorithmen der sozialen Medien. Man kann Fake-Accounts anlegen oder Bots für die automatisierte und systematische Verbreitung der Inhalte.
Sowohl die Fake-Accounts als auch die Bots agieren nach ihrer Aktivierung autonom. In sozialen Medien imitieren sie menschliches Kommunikations- und Benutzerverhalten und verbreiten die vom Anleger gewünschte Desinformation. Stichwörter (Hashtags) können Nutzern folgen oder massenhaft Beiträge kommentieren und dadurch die darin enthaltene Meinung unterstützen, verstärken oder entkräften – je nach Wunsch.
Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ist es inzwischen außerdem möglich, gefälschte Ton-, Bild- und Videoaufzeichnungen etwa von Politikern zu erstellen. Diese nennt man in der Fachsprache Deepfakes. Die gefakten Aufnahmen lassen Politiker Aussagen machen, die diese nie getätigt haben.
Ein Beispiel: Im November 2023 tauchte ein täuschend echt wirkendes Video von Bundeskanzler Olaf Scholz in den sozialen Medien auf, in dem er vermeintlich ankündigte, die Bundesregierung wolle ein Verbot der Partei AfD beantragen. Es soll von einer linksgerichteten „Aktivistengruppe“ erstellt worden sein.
Mit der ständigen Weiterentwicklung von KI wird es künftig immer schwieriger werden, täuschend echt aussehende Deepfakes zu erkennen. Deshalb ist es immer angeraten, besonders drastisch erscheinende Aussagen von Prominenten oder Videos von ungewöhnlichen Ereignissen erst einmal nur wahrzunehmen, nicht aber hektisch weiterzuverbreiten, nur, weil diese vermeintlich in das Weltbild des jeweiligen Nutzers passen. Gerade dann sollte man besonders vorsichtig sein, da die Algorithmen inzwischen genau herausfinden, welche Meinungen und Interessen zu einem passen und welche nicht.








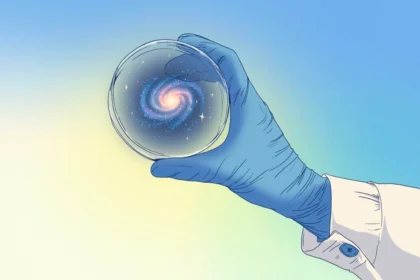
















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion