
Warum Medienvertrauen schwindet und was Journalismus jetzt leisten muss

In Kürze:
- Eine wachsende Zahl von Menschen meidet Nachrichten.
- Nur noch 43 Prozent der Nutzer vertrauen den Medien, die sie konsumieren.
- 41 Prozent glauben, die Bevölkerung in Deutschland wird von Medien teilweise belogen.
- Ist konstruktiver Journalismus ein Weg aus der Glaubwürdigkeitskrise?
Ob in der Berichterstattung während der Corona-Zeit, bei internationalen Konflikten oder im Umgang mit deutschen Oppositionsparteien, das Vertrauen in Medien ist angeschlagen. Die Kritik reicht von inhaltlicher Einseitigkeit über Unterdrückung kritischer Stimmen bis hin zur Zensur. Zudem wird „der vierten Gewalt“ oft eine unangemessene Nähe zur Regierung attestiert.
Die Vertrauenskrise ist messbar, und das international. Eine breit angelegte Studie der Oxford University zeigt, dass immer mehr Menschen Nachrichten aktiv vermeiden. Im Jahr 2022 waren das 38 Prozent der Befragten, während es fünf Jahre zuvor, 2017, noch 29 Prozent waren.
In Deutschland vertrauen laut Reuters Digital News Report 2024 nur noch 43 Prozent den Nachrichten, die sie konsumieren. Und bei den unter 25-Jährigen sind es sogar nur 38 Prozent, Tendenz rückläufig. Besonders problematisch: Über zwei Drittel der Befragten geben an, Nachrichten aktiv zu vermeiden, 14 Prozent sogar oft. Gründe dafür seien unter anderem emotionale Erschöpfung, Reizüberflutung und das Gefühl, ohnehin nichts verändern zu können.
[etd-related posts=“5145729″]
Eine Erhebung der Universität Mainz (2025) konstatiert zwar ein „stabiles Grundvertrauen“, stellt jedoch fest, dass die Hälfte der Befragten befand, dass die etablierten Medien in der Bundesrepublik nur ein Sprachrohr der Mächtigen seien. 41 Prozent stimmten der Aussage zu, 20 Prozent sogar voll und ganz, dass die Bevölkerung in Deutschland von den Medien systematisch belogen wird. 38 Prozent der Befragten gaben an, zu glauben, dass etablierte Medien mindestens teilweise die Meinungsfreiheit beschneiden.
Laut der Studie war das Medienvertrauen mit 56 Prozent besonders stark im ersten Corona-Jahr, 2020. 2023 hatte es den Tiefpunkt von 44 Prozent erreicht. Für das letzte Jahr gaben die Studienautoren den Wert mit 47 Prozent an.
Gefühlte Meinungsfreiheit im Abwind
Neben der Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit der Medien hat sich auch das individuelle Empfinden der Menschen zur Meinungsfreiheit geändert. Laut Freiheitsindex des Instituts für Demoskopie Allensbach waren im Jahr 2023 nur noch 40 Prozent der Befragten der Meinung, ihre politische Meinung frei äußern zu können – der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung 1990. Im vergangenen Jahr stieg dieser Wert wieder auf 47 Prozent.
[etd-related posts=“5097427″]
Erklärungen für diese Entwicklung bieten sich einige an:
Wer sich in der Corona-Zeit kritisch zu den Maßnahmen der Politik äußerte, wurde zum „Corona-Leugner“ abgestempelt. Aussagen, die inzwischen sogar von offiziellen Stellen bestätigt wurden, galten damals als tabuisiert oder wurden diskreditiert. Auch die Ukraine-Berichterstattung offenbarte ein neues Frontendenken. Wer etwa auf geopolitische Vorgeschichte oder NATO-Strategien hinwies, sah sich der Diffamierung als „Putin-Versteher“ ausgesetzt. Laut den Studienmachern aus Mainz vertrauen 40 Prozent der Befragten der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.
Deutlich weniger Glaubwürdigkeit wird Meldungen und Bildern aus Gaza eingeräumt. Nur 27 Prozent vertrauen den Berichten überwiegend oder vollkommen, ebenfalls 27 Prozent äußerten kein Vertrauen.
Einseitige Narrative dominieren in der Gaza-Berichterstattung. Je nach Position des Mediums bekommen kritische Stimmen – ob jüdische, palästinensische oder internationale – nur begrenzten Raum, wenn sie nicht in die geforderte Deutung passen. Das Prinzip auf den Punkt gebracht: Komplexität wich Polarisierung.
[etd-related posts=“5211215″]
Wie viel Zensur verträgt eine Demokratie?
In Deutschland mag nicht zuletzt der mediale Umgang mit der Opposition das Vertrauen in etablierte Medien erschüttert haben. Veranschaulicht in Zahlen: Im Februar 2025, dem Monat nach der letzten Bundestagswahl, kamen die Grünen mit 13 Einladungen in Talkshows auf 21 Prozent der Fernsehauftritte deutscher Politiker – bei einem Wahlergebnis von nur 11,6 Prozent. Die AfD erhielt trotz 20,8 Prozent bei der Wahl lediglich eine einzige Einladung – ein Anteil von 1,6 Prozent, wie die „Weltwoche“ berichtet.
Die Unterdrückung, einseitige Behandlung und Verbannung von Themen und Gesprächspartnern führten dazu, dass 35 Jahre nach dem Ende des DDR-Regimes in Deutschland wieder über Zensur gesprochen wird, auch wenn sie selten formalistisch, sondern oft algorithmisch oder redaktionsintern wirksam ist. Offiziell gilt immer noch Grundgesetz, Artikel 5:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
[etd-related posts=“5114428″]
Journalistische Schieflagen: Haltung statt Aufklärung
Zensur in den westlichen Demokratien ist heute subtiler. Sie funktioniert über Reichweitenkontrolle, Themengewichtung und Plattformregeln. Kritische Perspektiven werden nicht verboten, aber aus dem sichtbaren Raum gedrängt. Die Staatsmacht hilft dabei. Durch Gesetze wie den DSA und das NetzDG wird Druck auf Plattformen aufgebaut, Inhalte zu regulieren. Oft bleibt unklar, was als „illegitim“ gilt.
In dieser Gemengelage tritt eine weitere Verschiebung zutage: der Rückzug des Journalismus in moralische Gewissheiten. Was mit wohlwollender Haltung beginnt, endet oft in einer Verwechslung von Aktivismus mit Journalismus.
Der klassische Grundsatz, Information und Meinung zu trennen, wird zunehmend verwässert. Der Journalismus soll objektiv und unparteiisch über Ereignisse und Themen berichten, so lautet zumindest eine Idealvorstellung. Dann kann sich das Publikum selbst eine Meinung bilden. Dieses Ideal ist und bleibt wohl ein Wunschtraum, zeigt Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen in seinem neuen Buch „Staatsfunk – ARD & Co. sind am Ende – oder müssen neu erfunden werden“. Er zitiert den Journalisten und Publizisten Walter Lippmann, der schon 1922 notierte:
„Eine Gruppe von Menschen, die der Öffentlichkeit den ungehinderten Zugang zu den Ereignissen verwehren kann, arrangiert die Nachrichten, damit sie ihren Zwecken dienen.“
Dies ist heute umso sichtbarer, da in manchen Redaktionen gar kein Anspruch mehr auf Pluralismus und Meinungsvielfalt besteht. Der Fall von Julia Ruhs ist nur die Spitze des Eisbergs. Journalisten sehen sich zunehmend als Aktivisten für bestimmte soziale, politische oder ökologische Anliegen.
[etd-related posts=“5250117″]
Klicks statt Kontext
Ein weiterer Treiber der Vertrauenskrise ist der ökonomische Druck. In der Ära der Aufmerksamkeitsökonomie müssen Medien mit sozialen Plattformen um Reichweite, Verweildauer und Emotionen konkurrieren. Die Folge: verkürzte Schlagzeilen, Überbetonung von Konflikten, Skandalen und Personalien – Clickbait auf Englisch.
Gleichzeitig verschärfen Algorithmen von Facebook, YouTube und Co. das Problem, indem sie Empörung und Polarisierung belohnen. Wer komplex berichtet, verliert gegen den, der laut ist. Immer mehr Nutzer ziehen Konsequenzen: Sie machen Mediendiät wie ich hier im Selbstversuch.
[etd-related posts=“5189570″]
Ein möglicher Weg aus der Glaubwürdigkeitskrise ist der konstruktive Journalismus. Dieser zielt nicht darauf, Probleme schönzureden, sondern sie kontextualisiert, ergänzt und lösungsorientiert darzustellen. Konstruktiver Journalismus ist kein „Feel-good-Journalismus“. Er will aber „nicht nur Probleme und Missstände darstellen, sondern auch den Blick in die Zukunft richten und Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten recherchieren, Perspektiven und Hoffnung zeigen“, heißt es im Einleitungssatz zu einer Studie (2018) von Klaus Meier, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Wird konstruktiver Journalismus belohnt?
Auch bei der Epoch Times erscheinen zunehmend Artikel, die diesen Ansatz verfolgen, so beispielsweise in der Kategorie Vital über die Auswirkungen des Konsums hochverarbeiteter Lebensmittel und darüber, welche einfachen Alternativen dazu im Supermarktregal zu finden sind, oder Artikel, die Hoffnung durch gute Beispiele geben, wie der über den US-Entertainer Jay Leno, der in beständiger Liebe seinen Platz an der Seite seiner an Demenz erkrankten Frau einnimmt. Neben tagesaktueller Politik und umfangreich recherchierten Hintergrundartikeln kommen bei Epoch Times immer wieder Experten mit alternativen Ideen und Lösungsansätzen zu Wort. Auch gibt es Ratgeberartikel mit hohem Nutzen für den Leser, beispielsweise über Sparmöglichkeiten angesichts der steigenden Energiekosten.
[etd-related posts=“5171059, 5114428″]
Der Journalismus der Zukunft braucht nicht mehr Lautstärke, sondern mehr Glaubwürdigkeit. Und er muss den Mut haben, auch sich selbst infrage zu stellen. Journalismus ist kein Erziehungsapparat. Er ist – oder sollte es sein – eine Einladung zur gemeinsamen Wirklichkeitsdeutung. Denn Medien sind dann stark, wenn sie die Mündigkeit ihrer Nutzer nicht fürchten, sondern fördern, und sich die Politik durch kritischen Journalismus kontrolliert sieht.
Wenn dies gegeben ist, können wir Medien auch als vierte Gewalt im Staat bezeichnen.
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.








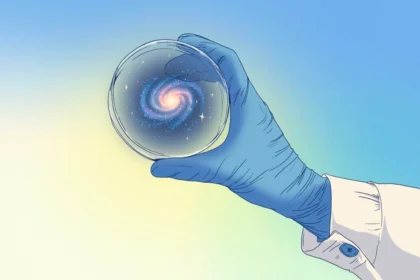







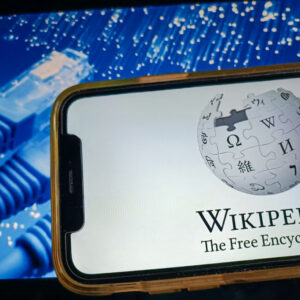








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion