
Shakespeares düstere „Prognose“ des leeren Materialismus in „Macbeth“

Wenn es jemals ein Stück über nichts gab, dann ist es Shakespeares „Macbeth“. Ich meine natürlich nicht, dass in diesem Stück nichts passiert. Es passiert viel, und zwar auf spektakulär blutige Weise. Doch das zentrale Thema des Stücks ist genau das „Nichts“. Das Wort „Nichts“ erscheint 16 Mal in „Macbeth“ und ist damit eines der zentralen Themen des Stücks.
Um zu verstehen, wie das Nichts das Thema des Stücks sein kann, wenden wir uns den Schriften des Heiligen Augustinus von Hippo zu. In seinem Buch „Das Enchiridion über Glaube, Hoffnung und [Nächsten-]Liebe“ befasst sich Augustinus mit der Frage: Was ist das Böse? Als Christ glaubte Augustinus fest an die Güte Gottes und daran, dass das von Gott geschaffene Universum daher grundsätzlich gut sein muss. Wie lässt sich dann die Anwesenheit des Bösen in der Welt erklären?
Augustinus’ Erforschung des Bösen
Er antwortete, dass das, was wir Böses nennen, in Wirklichkeit das Fehlen oder der Mangel an einem Gut ist, das vorhanden sein sollte. Es ist eine Verderbnis von etwas, das ursprünglich etwas Gutes war. So schreibt Augustinus:
„Auch an einem tierischen Leib ist beispielsweise Kranksein und Verwundung nichts anderes als ein Mangel der Gesundheit; denn wenn es sich darum handelt, solch einen Schaden zu heilen, so geschieht das nicht in der Weise, daß die vorhandenen Übel, also die Krankheit und die Wunden, nun abziehen müssen und sich da oder dort irgendwo niederlassen, sondern so, daß sie überhaupt kein Sein mehr haben; denn Wunden oder Krankheit sind ja selbst nichts Körperliches, sondern nur ein Mangel am Fleische […] Geradeso ist auch jeglicher Fehler an einer Seele nur ein Mangel an natürlichen Gütern.“
Mit anderen Worten: Das Böse ist Abwesenheit, Verderbtheit, Mangel. Das Böse ist an sich ein „Nichts“ und führt zur Verzweiflung, wie wir an Macbeths Abstieg vom Adel zur Bosheit sehen. Das Stück endet mit einem der erschreckendsten Ausdrücke der Verzweiflung in der gesamten Literatur: der „Morgen, und Morgen, und Morgen“-Rede. Shakespeare greift eindeutig auf diese augustinische Vorstellung vom Bösen zurück.
Zu Beginn des Stücks pflanzen drei Hexen, die Unheimlichen Schwestern, Macbeth eine Idee in den Kopf, die wie ein Spinnennetz wächst, sodass er sich schließlich in all seinen Gedanken verstrickt. Sie verkünden ihm, dass er König von Schottland werden wird.
Diese Idee – zunächst nicht mehr als ein Flüstern – entzündet in Macbeth den Ehrgeiz. Die Flamme wächst zu einem tosenden Inferno heran, das Macbeth und alle um ihn herum verzehrt und zerstört.
Macbeth beschließt, die Prophezeiung der Hexen wahr werden zu lassen. Er ermordet den herrschenden König Duncan und nimmt dessen Platz ein – nur um in einen endlosen, elenden Kreislauf aus Mord und Täuschung zu geraten, während er versucht, das Verbrechen zu vertuschen und die Krone zu behalten.

Detail eines Gemäldes des Heiligen Augustinus von Philippe de Champaigne. Foto: Gemeinfrei
Die Wiederholung von „Nichts“
Die erste Stelle, an der das Wort „Nichts“ im Stück vorkommt, ist in einer Rede des schottischen Lords Ross, der mit Macbeth über dessen Erfolg bei der Niederschlagung eines Aufstands gegen den König spricht.
Zu Beginn des Stücks wird Macbeth als loyaler und edler Lord hervorgehoben. Er ist mutig im Kampf. Er ist ein guter Anführer. Er ist intelligent und einfühlsam. Shakespeare etabliert die Figur des Macbeth in diesem Licht, um die Tragödie seiner Verderbnis zu verstärken. Damit erlebt das Publikum den Prozess, dass selbst Menschen mit guten Eigenschaften dem Bösen nachgeben können.
Um Augustinus noch einmal zu zitieren:
„Mit Recht wird gewiß ein unverdorbenes Wesen gerühmt; ist es aber auch noch unverderblich, so daß es einer Verderbnis überhaupt nicht ausgesetzt ist, so verdient es ohne Zweifel noch viel mehr Ruhm. Wird es aber einmal verdorben, so ist seine Verderbnis darum etwas Böses, weil sie es um irgendein Gut bringt.“
Nach und nach verliert Macbeth seine guten Eigenschaften.
Im selben Gespräch erfährt Macbeth, dass ein Teil der Prophezeiung der Hexen bereits eingetroffen ist: Macbeth wurde zum Thane (oder Lord) von Cawdor ernannt. Das schürt seinen Ehrgeiz. Später im Gespräch sagt Macbeth zu sich selbst (und zum Publikum):
„Wenn gut, – warum befängt mich die Versuchung?
Deren entsetzlich Bild aufsträubt mein Haar,
So daß mein festes Herz ganz unnatürlich
An meine Rippen schlägt.“
„If good, why do I yield to that suggestion
Whose horrid image doth unfix my hair
And make my seated heart knock at my ribs.“

„Macbeth and the Witches“, um 1830, von Thomas Barker of Bath. Foto: Folger Shakespeare Library
Er beginnt, mit dem Gedanken zu spielen, den König zu ermorden, obwohl ihm der Gedanke zu diesem Zeitpunkt noch zuwider ist. Macbeth fährt fort:
„Erlebte Greuel
Sind schwächer als das Grau’n der Einbildung.
Mein Traum, des Mord nur noch ein Hirngespinst,
Erschüttert meine schwache Menschheit so,
Daß jede Lebenskraft in Ahnung schwindet,
Und nichts ist, als was nicht ist.“
„Against the use of nature? Present fears
Are less than horrible imaginings:
My thought, whose murder yet is but fantastical,
Shakes so my single state of man that function
Is smother’d in surmise, and nothing is
But what is not.“
Der Satz „Nichts ist, als was nicht ist“ ist aus zwei Gründen bedeutsam. Shakespeares brillanter Einsatz von Enjambements – im englischen Orginal – spricht Bände: Der Zeilenumbruch nach „ist“ lässt den ersten Teil des Satzes wie einen abgeschlossenen Gedanken erscheinen: „Nichts ist.“ Diese Aussage ist das Credo des Nihilisten. Sie umfasst das Nichts, leugnet die Existenz und damit das Gute. Sie ist eine direkte Vorahnung der ausdrücklich verzweifelten und nihilistischen Proklamation Macbeths am Ende des Stücks in der „Morgen“-Rede.
Der zweite Grund für die Bedeutung dieses Satzes liegt darin, dass er in seiner Gesamtheit – „nichts ist, als was nicht ist“ – einen klaren Widerspruch, eine Umkehrung, eine Verneinung darstellt, ein Wesensmerkmal des Bösen. Das Böse infiziert Macbeths Gedanken.
Das nächste Mal, dass Macbeth das Wort „nichts“ verwendet, (im deutschen mit „nur Männer“ übersetzt) ist in einer Rede an seine Frau, die intrigante Lady Macbeth. Er sagt:
„Gebär’ mir Söhne nur!
Aus deinem unbezwungnen Stoffe können
Nur Männer sprossen.“
„Bring forth men-children only;
For thy undaunted mettle should compose
Nothing but males.“
Dann beschreibt er den Mord, den er begehen wird.
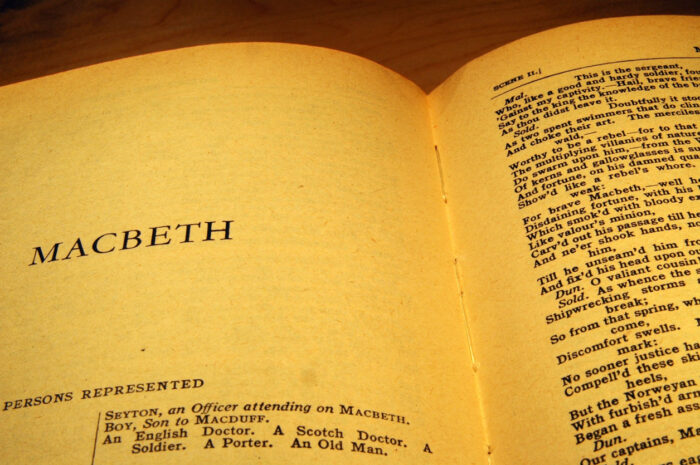
William Shakespeares „Macbeth“. Foto: JonNaust/iStock
Macbeths Befehl an seine Frau, nur männliche Nachkommen zu gebären, ist merkwürdig. Natürlich denkt er wahrscheinlich daran, sich einen Erben zu sichern, sobald er den Thron bestiegen hat. Doch er scheint auch anzudeuten, dass Lady Macbeths Mut, ihren Mann zum Mord an dem König anzustacheln, eher einem Mann als einer Frau gebührt. Dies ist eine bemerkenswerte Beobachtung, da Lady Macbeth kurz zuvor die dunklen Geister gebeten hat, ihr ihre Weiblichkeit zu nehmen.
In beiden Charakteren, Macbeth und Lady Macbeth, ist der natürliche Mut nun verdorben. Eine mutige Tat, im eigentlichen Sinne, muss auf ein gutes Ziel gerichtet sein. Sie ist eine Tugend. Aber der Wagemut, einen Mord zu begehen, ist eine Verderbnis von wahrem Mut, da sein Ziel etwas Böses ist.
Das nächste Mal, wenn wir das Wort „nichts“ hören, in Akt 2, Szene 3, versinkt Macbeth bereits in Verzweiflung. Trotz des Erfolgs seines Komplotts gegen den König, trotz des Gewinns, den er sich erhofft hatte, überkommt ihn tödliche Trauer und Leere – und das zu Recht. Wenn das Böse eine Abwesenheit ist, kann seine Frucht nur Nichtigkeit sein. Macbeth sagt:
„Wär’ ich gestorben, eine Stunde nur,
Eh’ dies geschah, gesegnet wär mein Dasein!
Von jetzt gibt es nichts Ernstes mehr im Leben:
Alles ist Tand, gestorben Ruhm und Gnade!
Der Lebenswein ist ausgeschenkt, nur Hefe
Blieb noch zu prahlendem Gewölbe.“
„Had I but died an hour before this chance,
I had lived a blessed time; for, from this instant,
There’s nothing serious in mortality:
All is but toys: renown and grace is dead;
The wine of life is drawn, and the mere lees
Is left this vault to brag of.“
Macbeth beginnt, etwas Wünschenswertes in der wahrgenommenen Nichtigkeit des Todes zu sehen. Für ihn ist „der Wein des Lebens ausgegossen“ – was bedeutet, dass die ganze Freude aus dem Leben entwichen ist. Es ist nichts mehr übrig. Er dachte, die Krone würde ihm neue Höhen des Glücks bringen, aber so funktionieren Mord und Schuld nicht.
Gleichfalls beklagt Macbeth in Akt 3, Szene 1:
„Das so zu sein, ist nichts:
Doch sicher, so zu sein. – In Banquo wurzelt
Tief unsre Furcht.“
„To be thus is nothing;
Stick deep;“
Mit anderen Worten: Macbeth sagt, König zu sein ist nichts, solange er immer noch Angst davor hat, seine Position zu verlieren. Er ist misstrauisch gegenüber seinem Freund Banquo geworden und beginnt, dessen Tod zu planen. Kaum hat Macbeth den Thron bestiegen, wird er von Paranoia und Schuld gequält.
„So zu sein, ist nichts.“ Hier verfällt Macbeth der menschlichen Neigung, niemals zufrieden zu sein. Und in diesem Fall verstärkt ein schlechtes Gewissen diese Tendenz erheblich. Da Macbeth die Krone auf unrechtmäßige Weise an sich gerissen hat, ist er unfähig, sich daran zu erfreuen.
Weil er selbst seinen König verraten hat, wird er von Ängsten gequält, dass andere ihn verraten werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod – nicht nur der buchstäbliche Tod, sondern auch geistige Leere. In Akt 3, Szene 4 sagt Macbeth kryptisch:
„Ich hab’ ein seltsam Gebrechen, das nichts ist
Für jene, die mich kennen.“
„I have a strange infirmity, which is nothing
Erneut erzeugt der Zeilenumbruch eine doppelte Bedeutung. Indem er die Zeile nach „nichts“ bricht, schafft Shakespeare einen vollständigen Gedanken vor dem Abschluss des Satzes: „Ich hab’ ein seltsam Gebrechen, das nichts ist.“ Das soll heißen, ich habe ein Leiden, und dieses Leiden ist die Nichtigkeit in Form von Nihilismus. Macbeths Seele wird von seinem philosophischen und moralischen Nihilismus zersetzt, und auf einer gewissen Ebene weiß er das.
Die letzte Erwähnung des Wortes „nichts“ kommt in der berühmtesten Rede des Stücks vor. Während sein Königreich um seine Krone herum zerfällt, nachdem er enorme Mengen Blut vergossen, gelogen, betrogen und dunkle Magie gesucht hat, verliert Macbeth beständig mehr und mehr von sich selbst und von den Dingen, die ihm einst Freude brachten.

„Die Bankettszene in Shakespeares ‚Macbeth‘“, 1840, von Daniel Maclise. Öl auf Leinwand. Guildhall Art Gallery; London. Macbeth sieht den Geist des Königs, den er ermordet hat. Foto: Gemeinfrei
In Akt 5, Szene 5 überbringt ihm jemand die Nachricht, dass seine Frau tot ist. Macbeths Antwort ist eine Rede von fast unerträglicher Sinn- und Hoffnungslosigkeit. Darin behauptet er, alles Dasein sei bedeutungslos:
„Sie hätte später sterben können; – es hätte
Die Zeit sich für ein solches Wort gefunden. –
Morgen, und morgen, und dann wieder morgen,
Kriecht so mit kleinem Schritt von Tag zu Tag,
Zur letzten Silb’ auf unserm Lebensblatt;
Und alle unsre Gestern führten Narr’n
Den Pfad des stäub’gen Tods. – Aus! kleines Licht! –
Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild;
Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht
Sein Stündchen auf der Bühn’, und dann nicht mehr
Vernommen wird: ein Märchen ist’s, erzählt
Von einem Dummkopf, voller Klang und Wut,
Das nichts bedeutet.“
In seiner gebrochenen Psyche ist das Leben für Macbeth ein „Schatten“ – ohne Substanz, eine Abwesenheit. Es ist Nichtigkeit, und es bedeutet nichts. Weil sich Macbeth dem Bösen ergeben hat – das eine Abwesenheit, nicht eine Präsenz ist –, hat er einen Punkt erreicht, an dem er das gesamte Dasein als abgrundtiefe Leere betrachtet. Alles wurde in das Vakuum der Sünde gesogen.
Es ist die logische Schlussfolgerung des Weges des Bösen. Die Welt in ihrer Helligkeit, in ihrer Präsenz, in ihrer Güte ist für Macbeth verloren, weil er sie abgelehnt hat, auf dem Weg ins Nichts und Nirgendwo.
Irgendwie wirkt Shakespeares Macbeth wie eine Vorwegnahme der nihilistischen Philosophie des 20. Jahrhunderts – und zeigt, wohin sie führt: zu moralischen Abgründen und Verzweiflung.
Indirekt hebt Shakespeare die Schönheit von Tugend und Güte hervor, indem er uns das Ergebnis ihrer Gegensätze zeigt. Dies macht „Macbeth“ zu einem von Shakespeares düstersten und doch profundesten Stücken.
[etd-related posts=“5218472,5215699″]
Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „‚Macbeth‘: A Play About Nothing“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung: sm)



vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion