
Von der Kanonenkugel zur Logikfalle: Das Münchhausen-Trilemma

Wer kennt sie nicht, die unterhaltsamen Geschichten über den Freiherrn Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, den deutschen Adligen aus dem 18. Jahrhundert (1720–1797), besser bekannt als „Lügenbaron“? Die niedergeschriebenen Erzählungen stammen jedoch nicht aus der Feder des Barons selbst. Andere Autoren brachten sie zu Papier.
Als Erster veröffentlichte der Deutsche Rudolf Erich Raspe im Jahr 1785 in London Geschichten über Münchhausen in englischer Sprache. Eine spätere Übersetzung ins Deutsche stammt von dem Göttinger Dichter Gottfried August Bürger (1747–1794), der die Erzählungen nach eigenem Ermessen weiter ausschmückte. Sein Werk „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Land, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen“ erfreute sich großer Beliebtheit.
In einer der berühmten Anekdoten reitet Münchhausen auf einer Kanonenkugel. In einer anderen Erzählung schafft er es, sich und sein Pferd aus dem Sumpf zu befreien, indem er sich am eigenen Zopf packt.
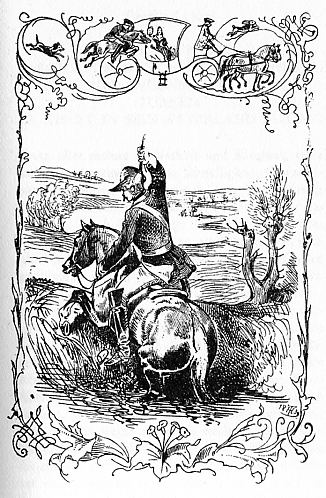
Illustration von Theodor Hosemann. Foto: gemeinfrei
Dieser Episode entstammt die bekannte Redewendung „sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen“. Physikalisch hingegen ist das unmöglich.
Logisch, aber auch wahr?
Rund 200 Jahre später, im Jahr 1968, griff der deutsche Philosoph Hans Albert (1921–2023) das Thema auf und prägte den Begriff „Münchhausen-Trilemma“. Dieser steht für die Schwierigkeit, den absoluten Beweis für eine Behauptung zu erbringen.
Um unsere Überzeugungen und Meinungen zu begründen, stützen wir uns oft auf Logik. Aber nicht immer sind die aus Argumenten gezogenen Schlussfolgerungen richtig. Dieses Phänomen erklärte Albert in seinem 1968 erschienenen Werk „Traktat über kritische Vernunft“. Mithilfe der Logik könne man verstehen, wie man aus einer bestimmten Annahme logisch richtige Schlüsse zieht und wann ein Argument korrekt ist.
Lautet eine Annahme „Alle Säugetiere sind Warmblüter“ und eine weitere „Wale sind Säugetiere“, kommt man zu der logischen Schlussfolgerung: „Wale sind Warmblüter“. Doch wenn eine Argumentation logisch erscheint, bedeutet das noch lange nicht, dass dies korrekt ist. Denn es gibt Annahmen, die im Grunde schon falsch sind, was zu falschen Schlussfolgerungen führt. Geht man beispielsweise davon aus: „Alle Hunde können fliegen“ – was natürlich falsch ist – und setzt dazu die Aussage: „Mein Rex ist ein Hund“, resultiert daraus die logische Schlussfolgerung: „Mein Rex kann fliegen“. Zwar ist diese Argumentation selbst logisch korrekt, aber Annahme und Schlussfolgerung entsprechen nicht der Realität.
[etd-related posts=“5270631″]
Was tun? Laut Albert müssen wir nicht nur jede Annahme einzeln begründen, sondern auch die jeweilige Begründung mit fundierten Argumenten unterlegen. So entsteht eine unendlich lange Kette von Begründungen. Erst wenn wir zu einem Punkt gelangen, an dem wir uns zu 100 Prozent sicher sein können, dass all unsere Annahmen sicher sind, können wir eine folgerichtige Schlussfolgerung ziehen.
Drei Möglichkeiten nach Albert
Laut Albert gibt es drei Möglichkeiten, diesem Phänomen zu begegnen:
1. Ein unendlicher Regress
Wenn jede Begründung eine weitere Begründung verlangt, kann der Erkenntnisprozess nie enden. Dann ist jede Erklärung nur vorübergehender Natur. Das kennt man von wissbegierigen Kindern, die ihren Eltern sprichwörtlich Löcher in den Bauch fragen.
Auf die Frage „Warum ist der Himmel blau?“ antwortet der Vater: „Weil die Streuung des Lichts in der Atmosphäre dazu führt, dass das blaue Licht stärker sichtbar ist.“ Sein Sohn fragt weiter: „Warum bewirkt die Streuung des Lichts das in der Atmosphäre?“ Die Antwort: „Weil blaues Licht eine kürzere Wellenlänge hat und sich daher in der Atmosphäre stärker streut“. Dann will das Kind wissen: „Warum hat Licht unterschiedliche Wellenlängen?“ „Weil Licht je nach seiner Energie unterschiedliche Eigenschaften hat“, so der Vater. „Und warum?“, bohrt der Junge nach. „Weil die Natur und die physikalischen Gesetze so funktionieren.“ Aber das Kind gibt nicht auf: „Und warum funktionieren die physikalischen Gesetze so?“ Die Fragerei geht unendlich weiter.
2. Zirkelschluss
Beim Zirkelschluss läuft die Argumentation nicht ins Unendliche, sondern im Kreis und begründet sich letztlich selbst.
Der Vater behauptet: „Gott existiert.“ „Und woher weißt du das?“, will der Sohn wissen. „Weil es in der Bibel steht“, so der Vater. „Aber woher weißt du, dass die Bibel wahr ist?“, kontert der Sohn. An diesem Punkt erkennt der Vater, dass dieses Gespräch vermutlich in einem unendlichen Regress endet, da er immer wieder neue Punkte anführen müsste, um die Wahrheit der Bibel zu untermauern. Um dies zu vermeiden, antwortet er kurz: „Die Bibel ist wahr, weil sie von Gott offenbart wurde.“
Mit anderen Worten: Die Behauptung, dass Gott existiert, basiert auf der Bibel. Und um zu beweisen, dass die Bibel wahr ist, wird darauf verwiesen, dass Gott existiert. Ähnelt das nicht der Geschichte, wie Baron Münchhausen sich und sein Pferd aus dem Sumpf zog, indem er kräftig an seinen eigenen Haaren zog?
3. Dogmatischer Abbruch
Um den Kreis der ständigen Argumentation zu durchbrechen, kann es auch zum dogmatischen Abbruch kommen. Das heißt, die Begründung wird an irgendeiner Stelle willkürlich beendet und als wahr angenommen. Diese ist die häufigste Variante, um das Münchhausen-Trilemma zu beenden. Viele Eltern kennen das. Wenn ein Kind fragt: „Warum ist das so?“, antworten sie: „Weil es so ist!“
Fazit ist, dass jede dieser drei Möglichkeiten uns nicht in die Lage versetzt, etwas endgültig zu beweisen. Jeder Versuch, einen Glauben oder eine Behauptung zu rechtfertigen, führt letztlich zu einer dieser Fallen und offenbart die Grenze der menschlichen Fähigkeit, absolute Gewissheit zu erlangen.
Die Lösung
Laut Albert liegt dem Problem der Wunsch inne, eine unumstößliche Wahrheit zu finden, auf der wir all unser Wissen und unsere Behauptungen aufbauen können. Er fragte sich: Was wäre, wenn wir die Suche nach einer solchen unfehlbaren Grundlage aufgeben würden?
Es ist wie bei einem Haus: Ein Haus benötigt ein solides Fundament. Gräbt man jedoch immer tiefer, um einen immer stabileren Untergrund zu finden, wird der Hausbau niemals begonnen. Ohne Fundament wiederum würde das Haus früher oder später einstürzen. In der Praxis wird daher ein bestimmtes Fundament gewählt – womöglich nicht perfekt, aber gut genug, um den Bau zu beginnen. Wenn später Probleme auftreten, kann das Fundament verstärkt oder das Haus repariert werden.
[etd-related posts=“4572018″]
Ähnlich können wir mit unseren Überzeugungen und unserem Wissen verfahren: Wir haben eine grundlegende Annahme gebildet, die uns als vertretbar erscheint, bleiben aber gedanklich flexibel, um sie bei Bedarf zu korrigieren. Albert beschrieb diesen Ansatz als kontinuierliches kritisches Denken – einen ständigen Prozess des Überprüfens und Korrigierens, anstatt nach absoluter Gewissheit zu streben.
Ein ständiger Prozess
Betrachtet man die fantastischen Geschichten des Barons Münchhausen aus moralischer Sicht, liegt die Frage nahe: „Darf man lügen?“ Eine mögliche Antwort könnte lauten: „Man darf nicht lügen.“ Gemäß Albert sollte diese Aussage als Hypothese betrachtet und im Laufe der Zeit in verschiedenen Situationen immer wieder geprüft werden.
Wenn man sagt „Wer lügt, spricht die Unwahrheit und das führt zu schlechten Konsequenzen“, könnte man hinterfragen, warum die Konsequenzen schlecht sein sollen.
Wer sich in einer Situation befindet, in der anderen die Wahrheit möglicherweise schaden könnte, könnte sich fragen: „Gibt es nicht auch Fälle, in denen eine Lüge moralisch gerechtfertigt ist?“ Oder anders gesagt: „Darf man lügen, wenn die Lüge Leben rettet?“
Entsprechend einer möglichen neuen Erkenntnis wird die Grundhaltung „Man darf nicht lügen“ der Situation angepasst. Möglicherweise kommt man dabei zu dem Ergebnis: „Man darf nicht lügen – außer in den Fällen, in denen eine Lüge Leben rettet oder erheblichen Schaden verhindert.“
Später wird man möglicherweise wieder das Gegenteil feststellen: „Egal, was passiert, man darf niemals lügen.“ Denn sobald Menschen allein entscheiden, wann eine Lüge gerechtfertigt ist, könnten sie anfangen, häufiger zu lügen. Wird dieser Ansatz von immer mehr Menschen praktiziert, führt dies in eine Gesellschaft, in der das grundlegende Vertrauen zwischen den Menschen vollständig erschüttert ist.
[etd-related posts=“5245841″]
Auch für die Behauptung „Gott existiert“ sollte man laut Albert nicht versuchen, eine endgültige, unerschütterliche Rechtfertigung zu finden. Besser sei es, diesen Glauben als vorläufige Annahme zu betrachten, zu akzeptieren und weiterzuentwickeln.
Wer mit Leid oder Ungerechtigkeit in der Welt konfrontiert wird, könnte sich fragen: „Wie kann es sein, dass Gott solches Leid zulässt?“ Bei näherer Betrachtung erkennt man etwas viel Komplexeres: „Gott existiert, aber seine Wege sind uns verborgen“ oder „Gott existiert und überlässt der Menschheit die Entscheidung, was in der Welt geschieht“. Nach einer solchen Anpassung und einem neuen Verständnis wird der Glaube ständig überprüft.
Doch ganz egal, ob es sich um moralische Prinzipien dreht oder den Glauben an Gott: Mit der Bereitschaft, alles im Licht neuer Erkenntnisse zu hinterfragen, bleiben wir gedanklich flexibel.
Dieser Artikel erschien im Original zuerst in der israelischen Ausgabe der Epoch Times. (deutsche Bearbeitung sua)



vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion