
Der Preis des Machterhalts: Frankreich in der sozialistischen Sackgasse

In Kürze:
- Macrons Führungsstil sei das Problem, sagt Ghislain Benhessa im Interview.
- Der neue Premier Lecornu verdanke sein Amt der Taktik der Sozialistischen Partei und der Aufkündigung der einzigen und wichtigsten Reform Marcos, der Rentenreform.
- Die politische DNA von Emmanuel Macron sieht Benhessa im sozialistischen „Staat im Staate“.
Die aktuelle Situation in Frankreich zeigt Ghislain Benhessa, dass derzeit Politiker um jeden Preis an ihren Posten festhalten wollen. Alles sei recht, außer sich einer Neuwahl zu stellen.
„Der Begriff des Gemeinwohls ist verschwunden“, sagt der Rechtsanwalt in Straßburg im Interview mit der französischen Epoch Times. Zurück bleibe eine Politik, die taub sei für die Realität, das Land und die Franzosen. Und es liege ein Hauch vom Ende einer Herrschaft in der Luft.
Benhessa ist Doktor der Rechtswissenschaften und Essayist. Aus seiner Feder stammen unter anderem die Bücher „Comment faire taire le peuple – Le référendum impossible“ und „On marche sur la tête ! La France, l’UE et les mensonges“. [1] Beide Bücher beleuchten die politische Lage Frankreichs und Europas und beschäftigen sich mit Demokratie, Mitsprache und Eliten.
Herr Benhessa, Premier Sébastien Lecornu hat am 16. Oktober seine Haut gerettet. Die Misstrauensanträge wurden abgelehnt. Stehen wir nun vor einer etwas stabileren Phase?
Das ist derzeit schwer zu sagen. Wir stehen erst am Anfang der Regierung Lecornu II. Sicher ist jedoch, dass der Premierminister seinen Verbleib im Amt dem Ausbleiben von Angriffen seitens der Sozialistischen Partei und der Les Républicains verdankt. Die Sozialisten haben nach der Ankündigung der Aussetzung der Rentenreform ihre Angriffslust gezügelt.
Die Rechte hat sich ihrerseits für eine Strategie der Stabilität entschieden, um eine erneute Auflösung zu vermeiden. Es ist klar, dass Neuwahlen sowohl für die Sozialisten als auch für die Republikaner und alle, die sich dem Macron-Block angeschlossen haben, in einem Desaster hätten enden können.
Allerdings ist dieses Bündnis äußerst fragil. Momentan sind die Sozialisten zufrieden. Aber wie lange noch? Es ist bereits abzusehen, dass sie weitere Zugeständnisse anstreben. Sie werden wahrscheinlich versuchen, die Regierung in ihren Forderungen zu überbieten.
Die Les Républicains ihrerseits sind tief gespalten. Zwei Lager stehen sich gegenüber: das von Bruno Retailleau und das von Laurent Wauquiez. Retailleau als Parteichef und Innenminister neigte zum Misstrauensvotum. Der Zweite, der an der Spitze der Abgeordnetengruppe steht, sprach sich dagegen aus. Damit bricht ein weiterer Führungskrieg auf der rechten Seite aus. Das ist nicht besonders glanzvoll, zumal die Partei nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, verglichen mit der Ägide der UMP [2] zu Zeiten von Nicolas Sarkozy.
In einer solchen Konstellation ist es schwierig, vorherzusagen, was auf politischer Ebene passieren wird. Die Sozialistische Partei, heute objektiver Verbündeter von Macrons Partei, könnte sich morgen wieder der linken La France Insoumise [3] annähern.
Ebenso ist es unmöglich, zu wissen, ob es für die Republikaner klug war, sich mit einem sterbenden zentralen Block zu verbünden. Vielleicht haben sie Sitze gerettet, aber ihre Linie ist nicht mehr nachvollziehbar, zumal einige ihrer Mitglieder nun Minister sind – inmitten eines allgemeinen Durcheinanders und gegen den Willen ihrer Parteiführung.
Wenn man Ihnen zuhört, kann Sébastien Lecornu den beiden traditionellen Regierungsparteien dankbar sein.
Absolut. Der Premierminister hat den Sozialisten ein goldenes Zugeständnis gemacht. Die Rentenreform war die symbolträchtige Reform der zweiten Amtszeit von Emmanuel Macron – wahrscheinlich die einzige.
Die Republikaner ihrerseits haben sich, mit Ausnahme einer Abgeordneten, dafür entschieden, die Regierung nicht zu kritisieren. Das Problem ist, dass das Schauspiel der Sozialistischen Partei, der Republikaner und des zentralen Blocks den Anti-Elite-Diskurs weiter anheizt.
Die Franzosen könnten diese politische Entwicklung als allgemeine Flucht nach vorn interpretieren – ein Zweckbündnis zwischen Parteien, die im Vergleich zum Rassemblement National mit Le Pen und Bardella sowie zur La France Insoumise von Mélenchon kein Gewicht mehr haben, aber um jeden Preis eine weitere Auflösung vermeiden wollen, die sie in den Abgrund reißen würde.
Alles ist recht, außer sich dem Wähler und der Wahlurne zu stellen.
Kann die Ankündigung der Aussetzung der Rentenreform auch als Eingeständnis der Schwäche von Macrons Regierung oder sogar des Präsidenten der Republik interpretiert werden?
Lassen Sie uns den Blick etwas erweitern. Emmanuel Macron kam vor acht Jahren mit einer zentralen Idee an die Macht. Er wollte dem Amt des Staatsoberhauptes nach der fünfjährigen Amtszeit von François Hollande neuen Schwung, Dynamik und Vertikalität einhauchen. Deswegen sprach man schnell vom „jupiterhaften“ Präsidenten.
Heute ist davon nichts mehr übrig. Er ist nun abhängig von einer Fünften Republik [4], die in ein parlamentarisches System kippt. Dieses wird wiederum von Kompromissen zwischen einigen Parteien zusammengehalten, die bei den Wahlen kaum eine Rolle spielen.
Unsere Institutionen funktionieren verkehrt herum. Wir sind in eine Phase der Instabilität und Unvorhersehbarkeit eingetreten, die das Gegenteil von Emmanuel Macrons Versprechen darstellt.
Doch das ist noch nicht alles. Der Präsident der Republik hat sein Versprechen, die öffentlichen Finanzen in Ordnung zu bringen, nicht eingehalten. Die wirtschaftliche Bilanz des „Mozart der Finanzen“ [5] ist katastrophal. Die Verschuldung steigt weiter und unser Defizit wächst Tag für Tag, was zu nervösen Debatten und zur Herabstufung Frankreichs durch Ratingagenturen führt.
Und in diesem Kontext verschwindet die einzige Reform, die überhaupt noch Einsparung bringen sollte, in der Versenkung, nur damit eine Regierung auf Bewährung noch etwas länger durchhält.
Die französische Politik liegt in Trümmern, zerstört von ihren eigenen Akteuren, allen voran Emmanuel Macron selbst, der die Ergebnisse seiner gescheiterten Auflösung nie berücksichtigte. Er träumte von einer „großen Klärung“ und richtete große Verwirrung an. Diese ist in ein regelrechtes Chaos umgeschlagen. Nicht die Fünfte Republik steht infrage, sondern das Verhalten der Person, die sie eigentlich schützen sollte.
Erscheint Ihnen die Regierung von Sébastien Lecornu als Marionette der Sozialistischen Partei, wie manche behaupten?
Ich bin nicht unbedingt anderer Meinung. Tiefer betrachtet sollten wir uns mit dem Wesen des Macronismus auseinandersetzen. Als Emmanuel Macron 2016 „En Marche“ ins Leben rief, kündigte er an, die Kluft zwischen rechts und links zu überwinden.
Im Laufe der Jahre näherte sich der Macronismus den Republikanern an, als der Rassemblement National in der Nationalversammlung an Stärke gewann. Manche dachten, der Macronismus sei zu einer politischen Mitte-rechts-Kraft geworden.
Doch die Ankündigung der Aussetzung der Rentenreform und die Annäherung an die Sozialistische Partei haben ein wichtiges Element im Wesen des Macronismus und in der Verortung des Staatschefs deutlich gemacht. Emmanuel Macron ist kein Mann der Rechten. Er stammt aus dem tiefen sozialistischen Staatsapparat.
Als Absolvent der École nationale d’administration absolvierte er eine Ausbildung zum Finanzinspektor, bevor er zur Rothschild-Bank wechselte. Er beteiligte sich an der Attali-Kommission zur Förderung des französischen Wirtschaftswachstums. Dann schloss er sich 2012 dem Wahlkampf von François Hollande an. Dieser ernannte ihn anschließend zum stellvertretenden Generalsekretär seines Kabinetts und später zum Minister.
Seit seiner Wahl stehen langjährige Mitglieder der Sozialistischen Partei an der Spitze der zentralen Institutionen. Einige Beispiele: Richard Ferrand übernahm als Nachfolger von Laurent Fabius die Leitung des Verfassungsrats, Pierre Moscovici die des Rechnungshofs, ganz zu schweigen von Martin Adjari, einem Vertrauten der Sozialistischen Partei, der zum Chef der Arcom [6] ernannt wurde.
Ein weiteres Beispiel ist Thierry Tuot, Autor des berühmten Berichts „La grande nation pour une société inclusive“ unter François Hollande. Der Text ist ein echtes Plädoyer für eine multikulturelle Gesellschaft. Tuot wurde von Macron zum Präsidenten der Innenabteilung des Staatsrats ernannt.
Wenn es darum geht, Männer für Schlüsselpositionen auszuwählen, greift er auf die Führer des Sozialismus nach Mitterrand zurück, die sich zunächst hinter François Hollande und später hinter Macron versammelten.
Und während die Parteien untereinander verhandeln, versinkt Frankreich weiter in der Wirtschaftskrise.
Frankreich verliert seit Jahren wertvolle Zeit. Wenn es Zeit verliert, dann deshalb, weil es in der Falle widersprüchlicher Diskurse gefangen ist.
Kürzlich verfolgte ich aufmerksam die Rede des ehemaligen EU-Kommissars Thierry Breton in einem Nachrichtensender. Er sagte, Frankreich müsse einerseits Reformen umsetzen, andererseits müssten die Parteien Kompromisse finden.
Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Land eine Führungskrise durchlebe und deshalb einen starken Präsidenten an der Spitze des Landes bräuchte.
Man kann jedoch nicht beides gleichzeitig wollen. Man kann nicht sowohl parteipolitische Kompromisse feiern, die an Verhandlungen im Hinterzimmer erinnern, als auch einen starken Präsidenten fordern, der das Land führt. Es geht nur das eine oder das andere, zumal der Präsident angesichts einer zersplitterten Nationalversammlung bis zum Ende seiner Amtszeit zwangsläufig schwach bleiben wird. Er kann nicht viel tun, außer Wege zu finden, die Auflösung der Nationalversammlung zu vermeiden und so lange wie möglich im Amt zu bleiben, vielleicht auch bis 2027.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, wird einem schnell klar, wie beschämend dieses Schauspiel ist. Emmanuel Macron spielt seit anderthalb Jahren auf Zeit. Und die Politiker denken nur daran, ihre Posten zu retten, und schmieden dafür für den Bürger völlig unverständliche Allianzen.
Der Begriff des Gemeinwohls ist verschwunden. Zurück bleibt eine Politik, die sich in sich selbst zurückzieht, taub für die Realität, das Land und die Franzosen. Es liegt ein Hauch vom Ende einer Herrschaft in der Luft, ohne dass man weiß, was danach kommt.
[1] In „Comment faire taire le peuple – Le référendum impossible“ analysiert Benhessa, wie die Souveränität des Volkes durch die Tabuisierung von Volksabstimmungen ausgehebelt wird. Politiker gäben die Kontrolle zunehmend an Richter und übergeordnete Institutionen ab und umgingen den Willen des Volkes.
In „On marche sur la tête ! La France, l’UE et les mensonges“ kritisiert er die Machtverteilung zwischen Finanzmärkten, Technokratie, Richtern und Eliteinstitutionen, die weit entfernt von der Bevölkerung entscheidet. Er geht hier auch auf die Bauernproteste und das Erstarken nationalistischer Parteien ein.
[2] UMP – Union pour un Mouvement Populaire, 2002 gegründet, diente als Bündnis mehrerer liberaler und konservativer Parteien. Unter Sarkozy war sie die dominante konservative Partei in Frankreich. 2015 wurde die UMP in Les Républicains umbenannt.
[3] Die La France Insoumise, kurz FI oder LFI, ist eine linke und EU-skeptische politische Bewegung, die 2016 von Jean-Luc Mélenchon gegründet wurde. Sie sieht sich als Alternative zu den traditionellen linken Parteien und fordert unter anderem Verstaatlichungen, den Ausbau erneuerbarer Energien und kostenlose Gesundheitsversorgung.
[4] Die sogenannte Fünfte Republik begann im September 1958 mit der fünften Verfassung, die auf einen Vorschlag Charles de Gaulles zurückgeht. Sie wurde per Referendum der Franzosen mit 80 Prozent angenommen.
[5] „Mozart der Finanzen“ ist ein Titel von Emmanuel Macron, da er von 2012 bis 2014 als Wirtschaftsminister unkonventionell an Finanz- und Wirtschaftsthemen heranging und damit einigen Erfolg hatte.
[6] Arcom ist die französische Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation. Tuot wurde im Februar 2025 für eine sechsjährige Amtszeit auf Vorschlag von und durch Emmanuel Macron ernannt.
Der Artikel erschien im Original in der französischen Epoch Times unter dem Titel „Sébastien Lecornu non-censuré : « Une séquence politique de sauve-qui-peut général », selon Ghislain Benhessa“. (deutsche Bearbeitung ks)
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.






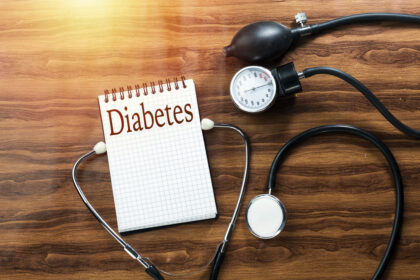






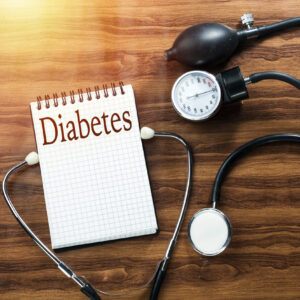











vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion