
Wird das Wort ersetzt – oder verlernt?
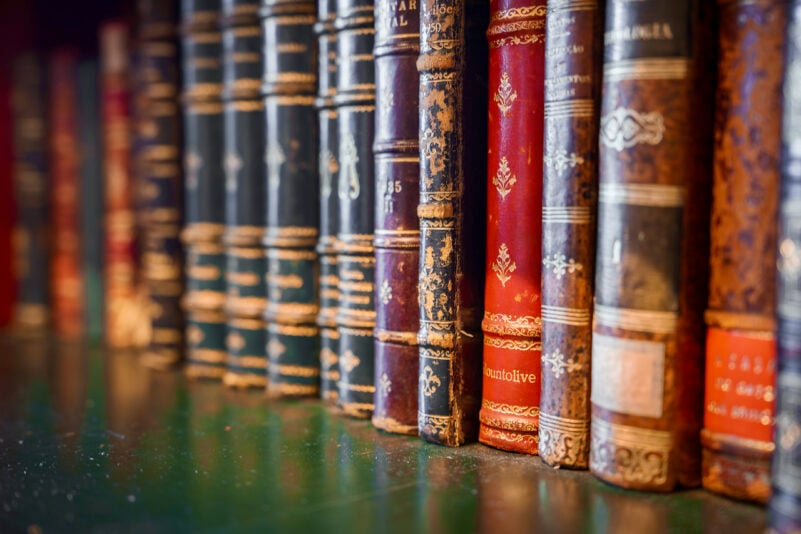
Sie lieben Podcasts? Falls ja, wunderbar. Dieses Format eignet sich hervorragend für lange Pendelfahrten, Spaziergänge oder um beim Training auch den Geist fit zu halten.
Freunde erzählen mir oft von großartigen Podcasts über Geschichte, Philosophie, Kunst und Religion. Diese Alternative zu den traditionellen Medien ist wertvoll, ja sogar unverzichtbar. Ich bezweifle auch nicht, dass einige von ihnen brillant produziert sind.
Allerdings habe ich schon zu oft schlechte Erfahrungen gemacht, um mich für dieses Medium im Allgemeinen begeistern zu können. Ich nutze nicht einmal die Standard-Podcast-App auf meinem Smartphone.
Sicherlich ist diese Abneigung meine persönliche Angelegenheit, aber eine typische Eigenheit vieler Sendungen finde ich geradezu deprimierend. Dabei geht es nicht um den Inhalt oder die grundsätzliche Haltung, sondern um das mangelnde Bildungsniveau: die Umgangssprache, die vulgäre Ausdrucksweise, das Geplapper, das sinnentleerte Geschwätz und jene Klangfärbungen beim Sprechen, die mit einem gewissen Stimmknarren und Füllwörtern zusammenhängen.
Mit anderen Worten: Zu viele Podcasts, denen ich ausgesetzt bin, wecken meine derzeit größte Angst.
Worum geht es dabei?
Ich fürchte, wir sind in ein neues Zeitalter des sprachlichen Verfalls und der Massenanalphabetisierung eingetreten. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen aufgehört haben zu lesen, was vermutlich zutrifft. Schwerer wiegt jedoch der Verlust einer gemeinsamen Sprache des Verstehens. Ein grundlegender Bildungskanon, der einst den Kern von Alphabetisierung und kultureller Teilhabe bildete, scheint von weiten Teilen mehrerer Generationen schlicht ignoriert worden zu sein.
[etd-related posts=“5293449,5281650“]
Eine reiche, ausgeprägte Kultur der Mündlichkeit ist etwas Großartiges. Sie war von Anbeginn der Zeit bis zum Zeitalter des Buchdrucks das vorherrschende Muster, in dem Menschen vor allem durch Zuhören und gemeinsames Erzählen lernten. Was heute jedoch entsteht, ist etwas anderes: Eine postliterale Gesellschaft, der jene Fähigkeiten fehlen, die in einer organisch gewachsenen mündlichen Kultur einst selbstverständlich waren.
Wir befinden uns in der Zeit nach den Lockdowns, als Schüler monatelang keinen Präsenzunterricht hatten und ihre soziale Welt ins Internet verlagerten. Ich kann immer noch kaum glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Die Daten sämtlicher Studien zu den Kompetenzen in Sprache, Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften sind verheerend. Einige Untersuchungen nach den Lockdowns zeigen den größten Einbruch der Lesefähigkeit innerhalb eines einzigen Jahres seit drei Jahrzehnten.
Ist das eine Anomalie oder der Vorbote einer Zukunft ohne Bücher und Alphabetisierung? Das frage ich mich momentan.
Abgesehen von dieser Generation ist der Mangel an Sprach- und Lesekompetenz im öffentlichen Raum ohnehin bereits zutiefst beunruhigend. Warum sollte es von Bedeutung sein, wenn wir in eine rein mündliche Kultur zurückfallen? Menschen, die häufig und vertieft lesen, sprechen in der Regel klarer und präziser. Sie verfügen über einen reicheren Wortschatz. Lesen schult die Ausdruckskraft. Zudem fördert es ein breiteres und tieferes Verständnis von Inhalten.
Mit anderen Worten: Lesen schult die Sprachfähigkeit und verbessert die Denkfähigkeit erheblich.
Was passiert, wenn das Lesen zurückgeht oder sogar ganz aufhört? Dann haben wir ein schwerwiegendes Problem. Und dieses Problem ist überall zu beobachten.
Nicht nur kann heute jeder einen Podcast starten, wodurch das durchschnittliche Niveau der Eloquenz erwartungsgemäß niedriger ist als früher. Es geht um noch mehr: Wir scheinen wirklich in eine neue Ära eingetreten zu sein, in der die Menschen nicht einmal mehr versuchen, ihr Unwissen zu beheben oder sich darum bemühen, mehr zu wissen und sich klarer auszudrücken.
Denken Sie einmal an die Zeit vor 150 Jahren zurück, als Bücher für den Normalbürger und für jedes Klassenzimmer erschwinglicher und leichter verfügbar wurden. Es war eine neue Ära für das Verlagswesen und den Vertrieb. Durchschnittshaushalte begannen zu träumen, dass auch sie sich eine Hausbibliothek leisten könnten, die zuvor nur den Reichen vorbehalten gewesen war.
Aufzeichnungen aus den 1880er-Jahren belegen, dass Eltern sich ernsthaft Sorgen machten, ihre Kinder würden ihre Hausaufgaben und das Spielen draußen im Freien vernachlässigen, während sie untätig das eine oder andere Buch lasen. Das Problem waren weniger Jane Austen und die Brontë-Schwestern, wenngleich die Reife der Themen in diesen Büchern die Eltern beunruhigte. Das eigentliche Problem war die Verbreitung von Groschenromanen.
[etd-related posts=“5271626,5290970“]
Die Eltern waren tatsächlich besorgt, dass ihre Kinder zu viel lasen. Bücher waren die Technologie, die jedem zur Verfügung stand – oft in Form von Fortsetzungsromanen in Zeitschriften, die ebenfalls weitverbreitet waren. Und diese waren nicht überall willkommen.
Eine Generation später stellten sich Sozialreformer jedoch eine neue Möglichkeit vor. Was wäre, wenn jeder Schüler durch einen Grundstock wunderbarer Bücher aus allen Bereichen eine umfassende Bildung bekommen könnte? Es entstanden neue Enzyklopädien in großer Zahl. Jedes Zuhause wollte ein eigenes Set besitzen, um den Kindern die besten Voraussetzungen zu bieten. In den 1920er-Jahren war dies ein nahezu allgemeines Ziel: eine umfassend gebildete Bevölkerung, ohne dass eine Gesellschaftsschicht zurückblieb.
Die Harvard Classics erschienen 1910. Es handelte sich um 50 sorgfältig ausgewählte Bücher, die für eine umfassende Bildung ausgewählt wurden. Sie galten als Mindestgrundlage an Wissen für einen gebildeten Menschen.
Eine Auswahl der Autoren umfasst Benjamin Franklin, Platon, Epiktet, Mark Aurel, Sir Francis Bacon, John Milton, Ralph Waldo Emerson, Augustinus, à Kempis, Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Cicero, Plinius, Adam Smith, Charles Darwin, Plutarch, Vergil, Cervantes, Bunyan, Äsop, die Brüder Grimm, John Dryden, Percy Bysshe Shelley, Browning, Lord Byron, Johann Wolfgang Goethe, Johann Christoph Friedrich von Schiller, Dante Alighieri, Homer, Edmund Burke, John Stuart Mill, Thomas Carlyle, Jean Racine, Molière, Gotthold Ephraim Lessing, David Macaulay, Henry David Thoreau, Aldous Huxley, Michel de Montaigne, Ernest Renan, René Descartes, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Machiavelli, Thomas Morus, Martin Luther, John Locke, David Hume, Joseph Lister, Louis Pasteur, William Wordsworth, Geoffrey Chaucer, William Blake, Konfuzius, Christopher Marlowe, William Shakespeare, John Webster und Blaise Pascal.
Wenn Sie die Hälfte dieser Namen kennen, gehören Sie vermutlich zu den besten 5 Prozent der gebildeten Menschen in den USA. Wahrscheinlich sind Sie außerdem älter als 60 Jahre. Wenn Sie sich zudem mit den Ideen dieser Personen auskennen, gehören Sie wahrscheinlich zu den obersten 1 Prozent.
Ich für meinen Teil kann nur wünschen, ich hätte eine Bildung genossen, die mir ein so umfassendes Wissen über all diese Werke vermittelt hätte. Das ist die Art von Bildung, die zu einem außerordentlich reichen Verständnis von Literatur und Leben führt. Ein Gymnasiast von heute, der diese gesamte Literatur diskutieren könnte, würde als Genie gelten.
Diese Bücher erschienen nicht nur aus kommerziellen Gründen. Ihre Veröffentlichung war von hohen Idealen geprägt. Sie spiegelten die Hoffnung wider, dass die gesamte Bevölkerung eine gemeinsame geistige Offenheit entwickeln würde. Die öffentlichen Schulen, die damals auf nationaler Ebene noch relativ neu waren, strebten tatsächlich danach, allen Schülern nicht nur grundlegende Kenntnisse zu vermitteln, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, die größten Werke der Weltliteratur kennenzulernen.
Bereits vor Einführung der Schulpflicht wurde die Teilnahme am öffentlichen Schulunterricht immer universeller. Dabei geht es nicht nur um die Grundschulbildung. So stieg die Quote der Absolventen einer höheren Schule von 18 Prozent im Jahr 1910 auf 51 Prozent im Jahr 1930. Dabei handelte es sich um anspruchsvolle Schulen mit höheren Standards als heutige Hochschulen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde schließlich auch das Hochschulwesen demokratisiert. Selbst in den 1980er-Jahren konnte ein Kind aus der Mittelschicht sein Studium und seine Bücher selbst finanzieren, eine solide Ausbildung bekommen und eine gute Karriere ansteuern.
In letzter Zeit hatte ich mit Doktoranden der Sozialwissenschaften zu tun, die an ihren Dissertationen arbeiten. Ich war wirklich erschrocken darüber, wie viele von ihnen nicht in der Lage sind, klar zu denken, zu schreiben oder zu sprechen – ganz zu schweigen davon, unabhängig zu denken. Sie wurden größtenteils förmlich zu Automaten ausgebildet, zu fügsamen Zynikern, die nur darauf getrimmt sind, sich anzupassen und durchzukommen.
Unter den Doktoranden, die ich kennengelernt habe, gibt es nur wenige, die einem überhaupt etwas mehr über die oben genannten Denker sagen könnten. Das ist leider nicht die Bildung des westlichen Geistes. Und man darf nicht vergessen: Wir sprechen hier von der Elite unserer heutigen Gesellschaft. Der Vormarsch der „woken” Ideologie und die Politisierung nahezu aller Disziplinen haben nicht nur Weisheit durch Dogma, sondern auch Gelehrsamkeit durch populistische Propaganda ersetzt.
Wie kann man dem entgegenwirken? Die „Harvard Classics“ aus dem Jahr 1910 und später können kostenlos aus verschiedenen Quellen heruntergeladen werden. Darüber hinaus sind gedruckte Ausgaben auf dem Gebrauchtmarkt für Bücher zu sehr günstigen Preisen erhältlich. Als Eltern sollten Sie sich einen Satz für Ihren Haushalt zulegen. Noch besser wäre es, sie zur Grundlage einer soliden Bildung zu machen.
Die Reformer von vor hundert Jahren hatten recht: Eine gebildete Bevölkerung ist möglich – es braucht nur neuen Willen und Entschlossenheit. Ich mache mir Sorgen, dass der Zustand der Bildung in der westlichen Welt schlechter ist, als wir alle ahnen. Das sollten wir ändern, bevor es zu spät ist.
Das Problem ist weniger das Verbot von Büchern, sondern vielmehr die Tatsache, dass das Lesen vernachlässigt wird. Es fehlt an Geduld und Anreizen. Außerdem ist immer etwas zur Hand, das sofortige Befriedigung verspricht. Ich denke, Podcasts von Meinungsmachern und politischen Provokateuren können diesen Verlust kaum ersetzen. Wenn das Lesen stirbt, taumelt die Zivilisation schlafwandelnd in die Tyrannei.
Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel The Literacy Crisis. (deutsche Bearbeitung ee)
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.



vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion