
Prozess zur Rundfunkbeitragspflicht: Verhandlung abgeschlossen – Urteil erst in 2 Wochen

In Kürze:
- Ein Urteil im Revisionsverfahren zur Rundfunkbeitragspflicht soll erst am 15. Oktober verkündet werden.
- Der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig schöpft damit die maximal zulässige Beratungsfrist aus.
- Erwartet wird ein Grundsatzurteil über Pflichten und Rechte von Sendern und Beitragszahlern.
- Eine 84-jährige Beitragsgegnerin hatte jahrelang gegen den „Bayerischen Rundfunk“ geklagt.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat am frühen Mittwochnachmittag die mündliche Verhandlung in einem Grundsatzstreit zur Rundfunkbeitragspflicht abgeschlossen.
Das Urteil wird am Mittwoch, 15. Oktober verkündet, erklärte der Vorsitzende Richter am Ende des Verhandlungstages. Damit schöpfe der zuständige 6. Senat die maximal zulässige Frist zur Verkündung eines Urteils vollständig aus. Geklagt hatte eine 84-jährige Frau aus Bayern, beklagte Partei ist der Bayerische Rundfunk (BR).
Prof. Dr. Eva Ellen Wagner, die Prozessbeauftragte des BR, stand vor Ort für ein Interview mit der Epoch Times nicht zur Verfügung.
[etd-brightchat-video=„https://vod.brightchat.com/embed/444b6eb7-d62a-4498-8c1e-d3acd90a6919“]
Anwälte der Klägerseite zuversichtlich
Dr. Harald von Herget, der Prozessbevollmächtigte der Klägerseite, erklärte nach der Verhandlung im Gespräch mit Epoch-Times-Reporter Erik Rusch, dass er „ganz zuversichtlich“ sei, was das anstehende Urteil anbelange.
Seinem Eindruck nach habe „die Erörterung der wesentlichen Punkte“ durch das Gericht auf jeden Fall gezeigt, dass „sehr wohl“ die Absicht bestehe, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) „auf den Zahn zu fühlen“. „Einer Entscheidung kann ich allerdings nicht vorgreifen und will auch da nichts mutmaßen“, sagte von Herget.

Die Rechtsanwälte der Klägerseite, Carlos Gebauer (l.) und Dr. Harald von Herget im Bundesverwaltungsgericht. Foto: Bildschirmfoto/Epoch Times
Der Münchener Jurist betonte, dass „zahlreiche Studien“ von Firmen wie etwa „Media Tenor“ ergeben hätten, dass der ÖRR seinen Auftrag nicht erfülle. Ein „systemisches Versagen“ sei von daher „eindeutig gegeben“. Es handele sich eben „nicht nur um Einzelfälle, wenn über einen längeren Zeitraum […] bestimmte Parteien nicht eingeladen“ würden und andere in den Programmen „überrepräsentiert“ seien, so von Herget. Derartige „Schieflagen“ existierten aber nicht nur im Bereich Politik, sondern auch beim Sport oder beim Thema Religion.
Zudem sei in der Verhandlung schon „herausgekommen“, dass die Programmbeschwerde alleine „kein ausreichendes Recht“ darstelle, um den Ausgleich zwischen den Interessen der Sender und jenen der Beitragszahler zu bewerkstelligen. Es benötige aus seiner Sicht „auf jeden Fall ein subjektives Klagerecht“ sowie „die Schließung der Legitimationslücke“, denn das Dilemma zwischen einer Pflicht und einer nicht genügenden Mitsprache sei im Fall des ÖRR nie gelöst worden.
Von Herget schlug vor, die Wahl der Rundfunkräte in die Hände der Rundfunkteilnehmer zu legen, damit diese eine „mittelbare Kontrolle“ über die Verwendung ihrer Gelder ausüben könnten. „Das ist auch möglich, ohne in die Programmautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzugreifen“, meinte der Prozessbevollmächtigte.
Gebauer: Diskussion um Partizipationsrechte „ins Laufen gekommen“
Auch sein Kollege Carlos A. Gebauer bestätigte, dass er die zuständige Kammer ebenfalls als „offen“ erlebt habe, „sich mit der anstehenden Problematik auseinanderzusetzen“. Er nehme aber nicht an, dass das ausstehende Urteil „zu einer endgültigen Lösung aller Probleme im deutschen Rundfunkrecht führen“ werde. „Aber es wird zumindest ein kleines Fenster geöffnet, mal neue Fragen zu stellen, die wir uns bislang nicht gestellt haben in Deutschland.“
Die Diskussion sei jedenfalls ins Laufen gekommen – auch, was die Frage der Bürgermitbestimmung betreffe:
„Wenn das unsere Demokratie und unser Rundfunk und unsere gemeinsame Meinungsbildung ist, dann wollen wir doch auch mitreden können, Teilhaberechte haben, Partizipationsrechte.“
Aus seiner Sicht sei es „eine völlig falsche Vorstellung“, dass der „Rundfunk eine eigene Person besonderer Rechtsgestalt sei, der sich völlig abgekapselt“ habe „von der Rechtsordnung und von rechtsstaatlichen Prinzipien“. Das müsse repariert werden, forderte Gebauer.
Auch er träume übrigens davon, dass die Rundfunkräte künftig nicht mehr von den Landtagen entsandt würden, sondern „dass alle Beitragspflichtigen aufgerufen werden, ihren eigenen Rundfunkrat basisdemokratisch zu wählen“. Das sei bei Krankenkassen oder der Rentenversicherung längst der Fall und lasse sich auch einfach durch die Landesgesetzgebungen umsetzen.
„Media Tenor“-Gründer „guter Dinge“
Auch der Gründer des „Media Tenor“-Instituts, Roland Schatz, sagte, er sei nach der mündlichen Verhandlung „guter Dinge“, dass der 6. Senat Klarheit schaffen könne. Die Zeiten, in denen Intendanten sagen konnten: „Ich sende, also bin ich“, seien vorbei. Wahrscheinlich werde die Sache aber noch die Verfassungsrichter in Karlsruhe final beschäftigen.

Die Rechtsanwälte der Klägerseite, Carlos Gebauer (l.) und Dr. Harald von Herget im Bundesverwaltungsgericht. Foto: Bildschirmfoto/Epoch Times
Die Position des BR sei aus seiner Sicht nicht wirklich „überzeugend“ gewesen, meinte Schatz. Das habe man auch der Reaktion des Saalpublikums entnehmen können. Er spielte damit auf einen Moment an, in dem die BR-Rechtsvertreterin Prof. Wagner – ihren Blick ins Publikum gewandt – erklärt hatte, der Sender nehme Programmbeschwerden der Zuschauer als Bausteine der Qualitätssicherung „sehr, sehr ernst“. Daraufhin erschallte vielstimmiges Gelächter.
Schatz wies darauf hin, dass externe Beschwerden beim ÖRR stets nur von internen Gremien behandelt würden. Das Publikum könne also nicht nachprüfen, wie damit umgegangen werde. Durchaus überprüfbar sei allerdings die Diskrepanz zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung.
„Und wenn jetzt hier heute, am 1. Oktober 2025, so getan wird, als würden die Kontrollgremien bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk auch nur im Ansatz funktionieren, dann weiß ich nicht, worüber wir reden. Mein Eindruck ist, dass Sie nicht existieren“, sagte Schatz.
Richter kritisierte Fehlen eines juristischen Gutachtens zur ÖRR-Vielfalt
Der Vorsitzende Richter Prof. Ingo Kraft hatte zwischenzeitlich zu verstehen gegeben, dass er viele Briefe von unzufriedenen Fernsehzuschauern erhalten habe. Insofern sei ihm bewusst, welche Probleme viele Beitragszahler mit dem ÖRR hätten. Kraft bemängelte nach Aussage von Epoch-Times-Reporter Rusch allerdings, dass die Klägerseite keine wissenschaftliche Arbeit vorgelegt habe, die die Vielfalt des ÖRR aus juristischer Sicht behandele.
Unter verschiedenen Untersuchungen sei von der Klägerseite aus auch eine Studie des Münchener Medienexperten Prof. Michael Meyen eingereicht worden, wie Rechtsanwalt von Herget gegenüber der Epoch Times bestätigte. Meyen arbeitet in München allerdings als Medienwissenschaftler, nicht als Jurist.
Der „Sachverständigenbeweis“ sei somit tatsächlich „noch zu führen“, räumte von Herget ein. Dies sei eigentlich Aufgabe des Bayerischen Verwaltungsgerichts (VG) gewesen. Das VG München habe aber in einer früheren Instanz davon abgesehen. Der damals involvierte Prozessbevollmächtigte Friedemann Willemer war zwischenzeitlich verstorben. Er selbst, so von Herget, habe als dessen Nachfolger vor dem BVerwG nur zur schriftlichen Erwiderung des BR Stellung beziehen können. Im Gerichtssaal habe er dann allerdings aus mehreren Studien, auch aus Langzeituntersuchungen, zitiert.

Eine Frau im Rollstuhl äußerte am 1. Oktober 2025 ihre Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Foto: Bildschirmfoto/YouTube/Marcus Fuchs
Im Umfeld der Verhandlung hatten sich bereits am Morgen einige Dutzend ÖRR-kritische Bürger versammelt. Vor und auf einer Bühne der Bürgerinitiative Leuchtturm ARD ORF SRG drückten viele von ihnen ihren Unmut über die ihrer Meinung nach unzureichende Arbeit speziell von ARD und ZDF aus.
[etd-related posts=“5157471,5145232″]
Die Ausgangslage
Der mündlichen Verhandlung war ein jahrelanger Rechtsstreit einer betagten Klägerin aus Bayern (heute 84) vorausgegangen, die namentlich bis dato nicht öffentlich in Erscheinung treten wollte.
Sie hatte sich geweigert, ihren Rundfunkbeitrag zu zahlen, weil die Sender ihrer Überzeugung nach nicht nur „kein vielfältiges und ausgewogenes Programm“ anböten, sondern auch „als Erfüllungsgehilfe der vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht“ dienten, wie das BVerwG auf seiner Website zusammenfasste. Zudem mangele es den ÖRR-Aufsichtsgremien nach Meinung der Klägerin an Staatsferne. Damit fehle es ihrer Ansicht nach „an einem individuellen Vorteil, der die Beitragspflicht rechtfertige“, woraus die Klägerin ein Leistungsverweigerungsrecht ableite.
[etd-related posts=“5252323,4129173″]
Die Bürgerinitiative Leuchtturm ARD ORF SRG und der Bund der Rundfunkbeitragszahler (BdR) unterstützten die Klägerin während des gesamten Rechtsstreits.

Der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts bot am 1. Oktober fünf Richter für die Entscheidung zur Zukunft der Rundfunkbeitragspflicht auf. Foto: Bildschirmfoto/Telegram/Wendezeit Hannover
Leipzig ließ Revisionsverfahren zu
Die Klägerin hatte sowohl im Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht München im September 2022 (Az.: M 6 K 22.3507) als auch mit ihrem Berufungsantrag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München (BayVGH) im Juli 2023 Niederlagen einstecken müssen (Az.: 7 BV 22.2642, PDF). Beide Gerichte argumentierten, dass unzufriedene Zuschauer sich ja bei den Sendeanstalten beschweren könnten.
[etd-related posts=“4953440″]
Der 6. Senat des BVerwG aber folgte am 23. Mai 2024 der Klageseite und ließ eine Revision zu. Der vorsitzende Richter Prof. Ingo Kraft vertrat die Ansicht, es sei an der Zeit, grundsätzlich zu klären, ob der ÖRR seinen Auftrag „strukturell verfehlt“, ein Programm anzubieten, welches der „Vielfaltssicherung“ dient. In diesem Fall würde es ja tatsächlich „an einem individuellen Vorteil“ für die Pflichtbeitragszahler fehlen.
Die Revision in Leipzig solle also feststellen, „ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen“ die Argumente der Klägerin „gegen die Beitragserhebung geltend gemacht werden“ könnten (Az.: BVerwG 6 B 70.23, PDF).
[etd-related posts=“4730879″]
Bundesverfassungsgericht für grundsätzliche Klärung der alten Streitfrage
Den Weg für eine neue Grundsatzentscheidung hatte letztlich ein Bandwurmsatz aus einem früheren Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 23. April 2023 (Az.: 1 BvR 601/23) frei gemacht. Der Türöffner lautete:
„Es ist jedoch weder dargelegt noch ersichtlich, dass bereits hinreichend geklärt ist, ob und gegebenenfalls nach welchen Maßstäben unter Berücksichtigung der Rundfunkfreiheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG und der Vielfaltsicherung dienenden Selbstkontrolle durch plural besetzte anstaltsinterne Aufsichtsgremien […] vor den Verwaltungsgerichten geltend gemacht werden kann, es fehle an einem die Beitragszahlung rechtfertigenden individuellen Vorteil […], weil das Programmangebot nach seiner Gesamtstruktur nicht auf Ausgewogenheit und Vielfalt ausgerichtet sei und daher kein Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbietern bilde.“
Der Erste Senat des BVerfG hatte zuletzt am 18. Juli 2018 ein positives Grundsatzurteil (Az.: 1 BvR 1675/16) zur Rechtmäßigkeit der Beitragspflicht pro Wohneinheit gefällt. Demnach genügt dafür schon alleine die Möglichkeit, den ÖRR zum eigenen Vorteil nutzen zu können: „Auf das Vorhandensein von Empfangsgeräten oder einen Nutzungswillen kommt es nicht an.“
Heißt im Umkehrschluss aber auch: Sollte ein Gericht irgendwann rechtskräftig feststellen, dass ein individueller Vorteil für den Beitragszahler beispielsweise wegen mangelnder Vielfalt im Programm fehlt, stünde auch die Beitragspflicht zur Debatte.








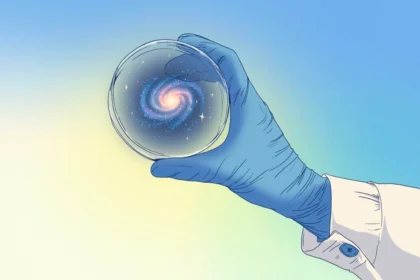







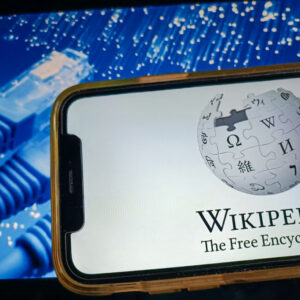








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion