
Autismus: US-Behörden warnen vor Paracetamol in der Schwangerschaft

In Kürze:
- Das US-Gesundheitsministerium warnt vor Paracetamol in der Schwangerschaft.
- Einige Studien deuten auf einen Zusammenhang mit Autismus und ADHS hin – andere widersprechen.
- Die Anzahl der Diagnosen von Autismus in den USA ist seit 2002 stark gestiegen.
- Ursachenforschung: Mischung aus genetischen Faktoren, Umweltgiften und veränderter Diagnostik.
- Die USA investieren 50 Millionen US-Dollar in neue Forschung zur Ursachenklärung.
Am Montag, 22. September, gaben Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und mehrere seiner Spitzenbeamten eine öffentliche Erklärung ab.
In dieser hieß es, man habe einen potenziell begünstigenden Faktor für Autismus identifiziert. Demzufolge begünstige Acetaminophen, die aktive Komponente von Paracetamol, neben anderen Faktoren ein mögliches Risiko für die Entstehung von Autismus und ADHS.
Gleichzeitig könne Leucovorin, ein Folinsäure-Präparat, ein möglicher Therapieansatz für Autismus sein.
Studienergebnisse
Den Spitzenbeamten des US-Gesundheitsministeriums zufolge seien die vorliegenden Erkenntnisse ausreichend, um eine offizielle Warnung herauszugeben. Dieser zufolge sollen Frauen auf die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft verzichten – zumindest solange keine angemessene Alternative zur Verfügung steht. Der Leiter der Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA, Dr. Marty Makary, äußerte in Washington:
„Die Daten, die uns vorliegen, können wir nicht mehr ignorieren.“
Im Wesentlichen berufen sich die US-Behörden auf zwei Studien. Die erste Studie aus dem Jahr 2019 der Boston University und der Johns Hopkins University School of Medicine untersuchte Nabelschnurplasma. Die Verfasser kamen dabei zu dem Schluss, dass die Exposition mit Paracetamol in der Gebärmutter das Risiko des Säuglings für neurologische Entwicklungsstörungen erhöhe.
Eine Metastudie aus dem Jahr 2025 ergab laut Dr. Andrea Baccarelli, Dekan an der Harvard TH Chan School of Public Health, und seinen Co-Autoren ebenfalls „Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft und einer erhöhten Inzidenz“ von neurologischen Entwicklungsstörungen.
[etd-related posts=“5228500″]
Umweltgifte, Gene oder Diagnostik? Debatte über die Auslöser
Demgegenüber sieht Dr. Sindhu Srinivas, Präsidentin der Society for Maternal-Fetal Medicine, diesen Zusammenhang als nicht hinreichend belegt an. Sie zitiert ihrerseits eine schwedische Studie aus dem Jahr 2024. Diese stütze sich auf Daten von fast 2,5 Millionen Kindern und lasse den behaupteten Zusammenhang nicht erkennen. „Derzeit ist die wissenschaftliche Beweislage, dass die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für Autismus oder ADHS mit sich bringt, schlichtweg nicht schlüssig“, sagte sie in einer Stellungnahme.
Auch in den Jahren 2021 und 2022 gab es Studien, die sich mit einem möglichen ursächlichen Zusammenhang zwischen Paracetamol in der Schwangerschaft und Autismus befasst hatten. Auch hier blieben die Schlussfolgerungen uneinheitlich.
[etd-related posts=“5072270″]
Das European Network of Teratology Information Services, welches Schwangere über Entwicklungsstörungen, die vor der Geburt auftreten können, informiert, distanzierte sich im April 2024 von der Annahme, Paracetamol trage zu Autismus oder ADHD bei. Allerdings wies man auch dort darauf hin, dass die Einnahme streng nach Verschreibung und nicht länger als erforderlich erfolgen sollte.
WHO widerspricht
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen angeblichen Zusammenhang zwischen Paracetamol und Autismus zurückgewiesen. Es gebe keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels und Autismus, sagte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic am Dienstag vor Journalisten in Genf.
Zwar hätten „einige Beobachtungsstudien einen möglichen Zusammenhang zwischen der pränatalen Paracetamol-Exposition und Autismus nahegelegt, aber die Angaben sind widersprüchlich“, betonte Jasarevic. „Mehrere andere Studien haben keinen solchen Zusammenhang nachgewiesen.“
„Wenn der Zusammenhang zwischen Paracetamol und Autismus stark wäre, wäre er wahrscheinlich in mehreren Studien durchgängig beobachtet worden“, sagte der WHO-Sprecher und warnte davor, „vorschnelle Schlussfolgerungen über die Rolle von Paracetamol bei Autismus zu ziehen“.
Autismusprävalenz steigt rasant – Ursachen bleiben umstritten
Kennedy erklärte im April, dass Faktoren wie genetische Veranlagung oder Umwelteinflüsse Bedeutung bezüglich eines Anstiegs der Prävalenz von Autismus haben können. Er hält die Zunahme an Fällen jedoch für so signifikant, dass diese nicht die einzigen Ursachen sein können. Er gibt sich sicher, dass auch Umweltgifte oder Arzneimittelunverträglichkeiten eine Rolle spielen.
Laut Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in den USA im Jahr 2002 bei 1 von 150 Kindern (0,67 Prozent) Autismus diagnostiziert. Nur 20 Jahre später waren 1 von 31 Kindern (3,23 Prozent) betroffen.
Dies sei keine natürliche Entwicklung, so Kennedy. Die US-Gesundheitsbehörden würden auch zu weiteren Faktoren forschen, die sie für potenziell relevant hielten.
Trotz der nunmehr vorgestellten jüngsten Studie bleibt die Ursachenforschung schwierig. Das CDC nennt neben Genetik das Alter von Eltern als möglichen Risikofaktor. Mögliche und noch wenig erforschte Einflüsse können auch Luftverschmutzung, Pestizide oder Lebensmittelinhaltsstoffe sein.
[etd-related posts=“4986135″]
Bessere Sensibilisierung – frühere Erkennung auch von leichteren Fällen
Die Autism Society of America geht davon aus, dass das öffentliche Bewusstsein für die Existenz von Autismus und die verbesserte Forschung zu den steigenden Fallzahlen beigetragen haben. Es gebe einen deutlich höheren Grad an gesellschaftlicher Sensibilisierung und das Thema sei nicht mehr tabuisiert. Die Definition von Autismus-Spektrum-Störungen sei zudem umfassender als in früheren Zeiten.
Zudem würden Ärzte, Eltern und Pädagogen besser geschult. Dies ermögliche es, mehr und auch mildere Fälle von Autismus zu diagnostizieren. In vielen Fällen erhielten Erwachsene eine Diagnose, deren Autismus im Kindesalter unerkannt geblieben sei. Heute gebe es demgegenüber mehr und frühere Diagnosen.
Die Organisation schreibt, dass „die Behauptung, dass Autismus ‚zu verhüten‘ sei, wissenschaftlich nicht fundiert ist und Menschen, Eltern und Familien unnötigerweise die Schuld gibt“.
[etd-related posts=“5241283″]
Um Antworten zu finden, fördert das Nationale Gesundheitsinstitut NIH aktuell 13 Forschungsprojekte zu Autismus mit 50 Millionen US-Dollar. Diese sollen mithilfe neuer Analysemethoden helfen, mögliche Ursachen besser zu verstehen und mögliche Therapien zu entwickeln.
Hoffnung auf neue Präparate auf der Basis von Folinsäure
Kennedy und Makari kündigten am 22. September weiterhin an, dass Folinsäure (Leucovorin), eine spezielle Form von Vitamin B9, einen vielversprechenden Ansatz für die Therapie von Autismus biete. Sie verkündeten, in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline ein Update für das Präparat Wellcovorin vorzubereiten.
Mehrere randomisierte, placebokontrollierte Studien in den USA wiesen die positiven Effekte von Folinsäure auf Autismussymptome nach. So verbesserte sich unter anderem die verbale Kommunikation. Auch in Frankreich und Indien konnten Kinder in standardisierten Tests deutlich höhere Werte erzielen. Allerdings gibt die Autism Science Foundation mit Sitz in New York zu bedenken, dass die Studien noch zu klein und zu unterschiedlich aufgebaut gewesen seien, um schon klare Aussagen zu erlauben.
Anm. d. Red.: Dieser Artikel wurde am 23.09.2025 aktualisiert, um die Einschätzung der WHO zu ergänzen.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)








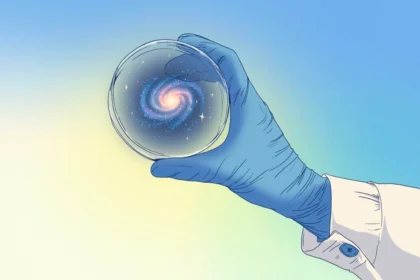
















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion