
Digitale Identität: Wo steht Europa im globalen Vergleich?

Weltweit schreitet die Einführung der elektronischen Identität voran. Ende September machte die Schweiz den Weg dazu per Volksabstimmung frei. Wie „swissinfo.ch“ berichtet, fiel das Votum denkbar knapp aus. So sprachen sich 50,4 Prozent für die Umsetzung des eID-Gesetzes aus, 49,6 Prozent lehnten das ab. Fast jeder zweite Schweizer beteiligte sich daran (49,6 Prozent). Auch in Großbritannien schreitet das digitale Konzept in großen Schritten voran – und ist dabei auch an Bedingungen geknüpft.
Britische Regierung will mit eID illegale Beschäftigung in den Griff bekommen
Ebenfalls Ende September kündigte Premierminister Keir Starmer laut „heise online“ den Start eines Projektes zur Einführung einer verpflichtenden eID an. Es soll bis zum Ende der Legislaturperiode (Juli 2029) umgesetzt sein. Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, die digitale ID zu nutzen, um die Arbeitsberechtigung von Bewerbern zu prüfen. Damit beabsichtigt die Regierung, illegale Beschäftigung einzudämmen. Zudem wird die digitale ID verpflichtend für alle, die arbeiten möchten.
[etd-related posts=“5262185″]
Ferner soll die eID als offizieller Nachweis von Name, Geburtsdatum, Nationalität und Aufenthaltsstatus dienen. Sie wird ein biometrisch verwertbares Foto enthalten und auf dem Smartphone gespeichert sein. Die digitale Identität soll nicht nur für staatliche Leistungen wie Sozialhilfe oder Gesundheitsdienste genutzt werden, sondern auch für private Angebote, etwa bei Banken oder Versicherungen. Damit wird sie zum zentralen Zugangsschlüssel für eine Vielzahl von digitalen Dienstleistungen.
Die Regierung betont jedoch, dass die Polizei nicht berechtigt sein wird, die eID bei Kontrollen einzufordern. Damit soll einer allgemeinen Ausweispflicht entgegengewirkt werden. In Großbritannien ist das Mitführen eines Ausweises bislang keine Pflicht. Die eID soll kostenlos und staatlich herausgegeben werden. Eine öffentliche Anhörung ist geplant, bevor ein entsprechender Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht werden soll.
In Deutschland ist die eID seit 2010 im Personalausweis verankert. Sie wird aber laut eGovernment-Monitor von nur etwa 25 Prozent der Bürger genutzt. Die Verbreitung leidet unter technischen Hürden wie Kartenlesegeräten und PIN-Eingabe, fehlender Verbindlichkeit bei Behörden und Unternehmen sowie einem Mangel an Wettbewerb unter eID-Dienstleistern. Dadurch bleiben viele Anwendungsfälle in der Privatwirtschaft aus.
[etd-related posts=“5146408″]
Koalitionsvertrag sieht für Deutschland ein verpflichtendes digitales Bürgerkonto vor
Um die eID endlich zum digitalen Standard zu machen, plant das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, eine Open-Source-Infrastruktur bereitzustellen. Damit will die Behörde Unternehmen und Dienstleistern den Aufbau eigener eID-Services erleichtern und Wettbewerb sowie Nutzerfreundlichkeit fördern.
Gleichzeitig verpflichtet die EU-Verordnung 2024/1183 Deutschland, bis Ende 2026 eine digitale Brieftasche (EUDI-Wallet) bereitzustellen, in der neben der eID auch Führerschein, Zeugnisse und weitere Nachweise hinterlegt werden können. Die Bundesregierung entwickelt dazu eine staatliche EUDI-Wallet, die kostenfrei verfügbar sein und bis 2027 schrittweise mit erweitertem Funktionsumfang in Betrieb gehen soll. Zugelassen werden zudem nicht staatliche Wallet-Lösungen, sofern sie die hohen Sicherheitsstandards erfüllen.
Darüber hinaus sieht der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung vor, ein verpflichtendes digitales Bürgerkonto einzuführen (Seite 58). Es soll EUDI-Wallet, BundID und weitere digitale Services verknüpfen und damit den Zugang zu Verwaltungsvorgängen vollständig digitalisieren.
Fast alle EU-Mitgliedstaaten betreiben inzwischen ein nationales eIDAS-Gateway (Node). Dabei handelt es sich um eine zentrale technische Komponente innerhalb der europäischen eIDAS-Infrastruktur, die den grenzüberschreitenden Austausch von elektronischen Identitätsdaten zwischen Behörden, Unternehmen oder Bürgern in EU-Mitgliedstaaten ermöglicht. Geregelt ist das in der eIDAS-Verordnung EU Nr. 910/2014. 25 von 27 Mitgliedstaaten (Stand Januar 2025) sind im eIDAS-Betrieb. Viele davon nutzen eine von der EU-Kommission bereitgestellte Mustersoftware für die Wiederverwendung digitaler eID-Lösungen. „Zu den Anwendungen gehören unter anderem klassische Smartcard-Personalausweise wie in Belgien, Estland und Spanien, das mehrgliedrige italienische SPID sowie mobile Lösungen wie Dänemarks MitID und Norwegens BankID.“
Die eIDAS-Verordnung schreibt seit September 2018 die gegenseitige Anerkennung aller notifizierten eID-Systeme in Verwaltungsverfahren vor, wodurch EU-Bürger ihre nationale eID grenzüberschreitend nutzen können. In Österreich etwa leitet der zentrale eIDAS-Knoten EU-Anwender direkt an ihr Herkunftssystem weiter und importiert einmalig die Identitätsdaten in das nationale Register. Ähnliches bieten Luxemburg, Litauen und Frankreich mit FranceConnect über Loginportale, während Schweden (BankID) und die Niederlande (DigiD) als inländische Authentifizierungslösungen weiter ausgebaut werden.
Schweden, Estland, Indien und Singapur sind weit fortgeschritten
In Schweden ist die Einführung der eID bereits sehr weit fortgeschritten. BankID gilt als fast flächendeckend eingeführt. Mehr als 8 Millionen Schweden, etwa 80 Prozent der Bevölkerung (Stand 2024), nutzen die mobile oder die Desktopvariante der BankID bereits für Onlinebanking, Behördengänge, Gesundheitsportale und private Dienste. Durch die enge Verzahnung mit allen großen Banken und Instituten kann heute fast jeder Bürger mit BankID fast alle Onlinedienste authentifizieren und rechtsverbindlich signieren.
Im weltweiten Vergleich sind mit Estland, Indien und Singapur drei Länder bei der Umsetzung der eID sehr weit fortgeschritten. So nutzt in Estland nahezu die gesamte erwachsene Bevölkerung die seit 2002 eingeführte eID-Smartcard oder Mobile-ID. Etwa 99 Prozent aller Behördengeschäfte werden mittlerweile digital über die X-Road-Plattform abgewickelt.
Singapur verzeichnet mit Singpass mehr als 6 Millionen aktive Nutzer und bietet damit eine einheitliche Authentifizierung inklusive rechtsverbindlicher elektronischer Signatur für Regierungs- und Privatdienste an. Die offizielle Einwohnerzahl beträgt rund 6,1 Millionen Menschen (Stand Juni 2025).
Indien weist laut dem Unique Identification Authority of India mehr als 1,3 Milliarden biometrisch verifizierte Aadhaar-IDs auf, über die mittlerweile Sozialleistungen, Bankkonten und SIM-Registrierungen abgewickelt werden. Gleichzeitig gibt es anhaltende Debatten zu Datenschutz und digitaler Inklusion.
Alles begann vor 25 Jahren
Die Geschichte der elektronischen Identität (eID) beginnt um die Jahrtausendwende, als Regierungen und Forschungseinrichtungen begannen, digitale Lösungen für die sichere Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern im Internet zu entwickeln. Ein frühes Beispiel war das EU-Forschungsprojekt „Facilitating Administrative Services for Mobile Europeans“ in den Jahren 2000 und 2001, das die Idee einer universellen digitalen Identität für grenzüberschreitende Verwaltungsdienste aufwarf. Ziel war es, mobile Europäer bei Umzügen zwischen Ländern digital zu unterstützen, etwa durch Smartcards und digitale Dokumentendienste.
Dabei wurde erstmals die Trennung von Authentifizierung und Autorisierung konzeptionell angedacht. So begannen die Entwickler, beide Prozesse als eigenständige Schritte zu betrachten. Mit der Authentifizierung, etwa mit Ausweis oder Login, wird die Identität des Nutzers überprüft. Was ihm gestattet ist, etwa der Zugriff auf bestimmte Daten, ist über die Autorisierung geregelt.
Den ersten praktischen Durchbruch erzielte Estland im Jahr 2002. Als postsowjetischer Staat ohne historisch gewachsene Verwaltungsstrukturen entschied sich Estland für einen digitalen Neustart. Die Regierung führte eine verpflichtende eID, integriert in den nationalen Personalausweis, ein. Diese digitale Identität ermöglichte nicht nur die sichere Anmeldung bei Behörden, sondern auch E-Voting, digitale Signaturen, Rezeptabholung und Steuererklärungen. Estland vernetzte seine staatlichen Datenbanken über die sogenannte X-Road-Plattform und wurde damit zum weltweiten Vorreiter für digitale Staatsführung.
In den folgenden Jahren zogen weitere europäische Länder nach. Belgien führte 2004 eine eID ein, Österreich etablierte die Handy-Signatur, später ID Austria.
Ein Meilenstein war die Verabschiedung der eIDAS-Verordnung (EU Nr. 910/2014), die einen europaweiten Rechtsrahmen für elektronische Identitäten und Vertrauensdienste schuf. Sie verpflichtete die Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Anerkennung ihrer eID-Systeme und ebnete den Weg für grenzüberschreitende digitale Verwaltungsdienste. 2024 folgte die bereits erwähnte EU-Verordnung 2024/1183, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, bis Herbst 2026 eine digitale Brieftasche bereitzustellen.








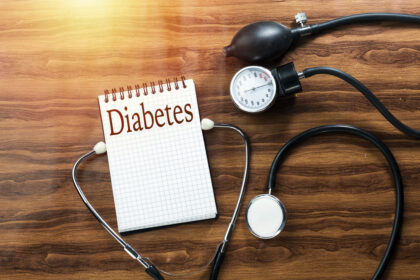





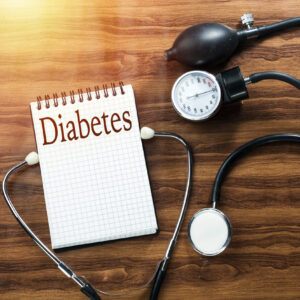










vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion