
Russische Gelder für die Ukraine? Belgien warnt vor Tabubruch – EU kann sich nicht einigen

In Kürze:
- Belgien blockiert die geplante EU-Finanzkonstruktion zur Ukraine-Hilfe
- Premier Bart De Wever fordert volle Haftungsteilung, Rechtsklarheit und gemeinsames Vorgehen aller Staaten
- EU will mit eingefrorenen russischen Zentralbankgeldern einen 140-Milliarden-Euro-Kredit absichern
- Juristen sehen Verletzung der Staatenimmunität – Risiko für Steuerzahler enorm
- Moskau droht mit Vergeltung: „Wenn ihr unser Geld nehmt, nehmen wir eures“
Die EU ist mit den Plänen für die Nutzung von eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Ukraine einen Mini-Schritt vorangekommen. Angesichts erheblicher Bedenken des zentralen Akteurs Belgien bleibt allerdings vorerst unklar, ob sie am Ende wirklich umgesetzt werden können. Eine Entscheidung soll kurz vor Weihnachten fallen, wie EU-Ratspräsident António Costa gestern Abend nach einem EU-Gipfel in Brüssel mitteilte, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei war. Heute Nachmittag will sich zudem die sogenannte Koalition der Willigen in London treffen, um über die weitere Unterstützung für Kiew vor dem Winter zu beraten.
Bei dem Treffen in Brüssel beauftragten die Staats- und Regierungschefs die EU-Kommission damit, so bald wie möglich einen Vorschlag zur Verwendung russischer Vermögenswerte vorzulegen. Auf Drängen Belgiens hin soll die Kommission allerdings auch andere Optionen zur Deckung des Finanzbedarfs der Ukraine für die Jahre 2026 bis 2027 erarbeiten, wie aus einer veröffentlichten Erklärung hervorgeht.
Von einer Einigung auf eine Nutzung des eingefrorenen Vermögens bleibt die EU damit ein ganzes Stück entfernt. Bundeskanzler Merz (CDU) äußerte vor drei Wochen noch die Erwartung, es werde beim Gipfel „aller Voraussicht nach dazu eine konkrete Entscheidung geben“. Die jetzige Erklärung ist aber nur ein erster Schritt in diese Richtung und nicht das erwartete starke Signal an Russland. Dazu trug auch bei, dass Ungarns Regierung – die einen vergleichsweise guten Draht nach Moskau hat – sich weigerte, den Text mitzutragen.
De Wever warnt EU vor möglichem Tabubruch
Der geplante Zugriff der EU auf eingefrorene russische Zentralbankguthaben stößt auf Widerstand aus Belgien. Premierminister Bart De Wever machte am Donnerstag, 23.10., in Brüssel deutlich, er werde der von der Kommission gewünschten Lösung „nicht zustimmen, solange drei Bedingungen nicht erfüllt sind“. Im Wesentlichen geht es darum, Belgien gegen mögliche unerwünschte Haftungsfolgen abzusichern.
Seit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 hat die EU die auf ihrem Territorium befindlichen Auslandsbestände der russischen Zentralbank eingefroren. Schätzungsweise sollen die Bestände 250 Milliarden Euro umfassen. Auf einen Teil davon will die EU jetzt zugreifen, um einen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro an die Ukraine zu vergeben.
[etd-related posts=“5281647″]
Der größte Teil davon lagert beim Finanzdienstleister Euroclear in Brüssel. Im Vorfeld des EU-Gipfels dort am 23. und 24. Oktober warnte De Wever vor einem möglichen historischen Tabubruch. Bis dato hatte die EU nur auf die Zinsen aus dem eingefrorenen Vermögen zugegriffen, dieses selbst jedoch unangetastet gelassen. Aus den Zinsen hatte die EU-Kommission bereits Vorhaben zugunsten der Ukraine im Gegenwert von 1,6 Milliarden Euro finanziert.
Nun möchte die EU auf den Kern des Vermögens zugreifen. Allerdings vermisst De Wever eine Rechtsgrundlage für diesen Zugriff, was er noch einmal deutlich machte. Er äußerte:
„Das ist nicht nur ein Detail. Nicht einmal während des Zweiten Weltkrieges wurden eingefrorene Bestände angetastet. Deshalb ist da ein sehr wichtiger Schritt.“
Belgien fordert eine vollständige Solidarhaftung aller Mitgliedstaaten
De Wever machte seine Zustimmung zur geplanten Maßnahme von der Erfüllung dreier Bedingungen abhängig. Zum einen müssten die übrigen EU-Mitgliedstaaten Belgien eine vollständige Risikoteilung bezüglich der Haftung zusichern. Andernfalls sei das Risiko Belgiens allein im Fall von Klagen zu groß.
Zudem verlangt De Wever Garantien der Mitgliedstaaten, wonach alle Länder anteilig haften, sollte das Geld zurückgezahlt werden müssen. Außerdem müssten Verfügungen über eingefrorenes russisches Vermögen gemeinsam erfolgen, damit Belgien nicht als einziger Mitgliedstaat exponiert sei.
[etd-related posts=“5281473″]
De Wever nannte es ein „Gebot europäischer Solidarität“, ein solches Experiment gemeinsam durchzuführen. Sei dies nicht gewährleistet, werde er das Vorhaben „mit allen rechtlichen und politischen Mitteln“ blockieren. Bereits zuvor hatte auch Italiens Premierministerin Giorgia Meloni gewarnt, die Stabilität und das Vertrauen im internationalen Finanzsystem nicht zu gefährden.
„Wir glauben, und wir sind nicht die einzigen, dass es notwendig ist, die internationalen Regeln und das Legalitätsprinzip zu respektieren.“
Rechtsgrundlage fraglich – EU-Konstruktion auf tönernen Füßen
Das von der EU mit Blick auf den Ukrainekonflikt regelmäßig angemahnte Völkerrecht ist eindeutig: Eine direkte Enteignung eingelagerter Zentralbankbestände eines Drittstaates gilt als Verletzung des Prinzips der Staatenimmunität und wäre rechtswidrig. Zudem sind die Auswirkungen auf das internationale Vertrauen in den Finanzplatz Europa ungewiss.
Als möglicher Kunstgriff zur Vermeidung einer Enteignung gilt deshalb die sogenannte Reparationsanleihe. Die EU würde sich zugunsten der Ukraine auf dem Kapitalmarkt verschulden, um diese weiten Waffen und weitere Güter liefern zu können. Dabei will sie das Geld der russischen Zentralbank als Sicherheit heranziehen.
[etd-related posts=“5279922″]
Merz und von der Leyen zuversichtlich – Russland droht mit Gegenmaßnahmen
Die Konstruktion lässt erkennen, dass die EU davon ausgeht, dass Russland den Krieg verlieren und dann bereit sein würde, als „Aggressor“ Reparationen an die Ukraine zu bezahlen. Auf diese Weise könnte ein möglicher Verlust der Zentralbankguthaben ausgeglichen werden. Die EU will faktisch Russland selbst für die offenen Summen bezahlen lassen.
Sollte es nicht so kommen, ist jedoch von einem Ausfallrisiko nahe 100 Prozent bezüglich der besicherten Kredite auszugehen – und dann hätten die Mitgliedstaaten dafür einzustehen. Die auf Deutschland entfallende Garantiesumme könnte etwa 35 Milliarden Euro umfassen. Anders als bisherige Hilfsprogramme wie die „Ukraine Facility“, die über den regulären EU-Haushalt laufen, wären direkte nationale Bürgschaften zur Absicherung nötig.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Friedrich Merz halten das Risiko für kalkulierbar und wollen an dem Vorhaben festhalten. Von der Leyen meint, ein Teil des mit russischem Guthaben besicherten Kredits werde auch der europäischen Rüstungsindustrie zugutekommen. Merz erklärte, er teile die Bedenken De Wevers, sei „aber zuversichtlich, dass wir Fortschritte machen werden“. Finnlands Premier Petteri Orpo meinte, es werde eine „rechtlich tragfähige Lösung“ geben, die Belgien berücksichtige – Details nannte er nicht.
[etd-related posts=“5280362″]
Die Russische Föderation lässt unterdessen keine Bereitschaft erkennen, sich dem Ansinnen der Europäer zu beugen. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, nannte den EU-Plan „null und nichtig“ und kündigte eine „schmerzhafte Antwort“ an. Auch der stellvertretende Finanzminister Alexej Moissej betonte, Russland habe bislang keine europäischen Vermögen beschlagnahmt – dies könne sich aber ändern, „wenn die EU ihre Linie ändert“. Ähnliches befürchtet auch De Wever – und verweist auf Beispiele:
„Putin wird reagieren. Google wurde in Russland für bankrott erklärt und enteignet – solche Maßnahmen können sich ausweiten.“







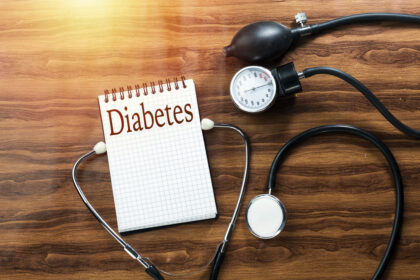


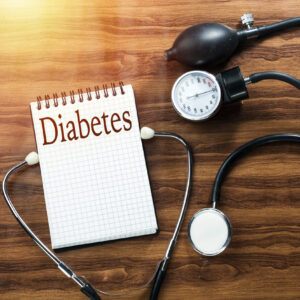














vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion