
Moldau-Wahl: Telegram-Chef wirft Paris Zensurversuch vor

In Kürze:
- Der Gründer von Telegram, Pawel Durow, erhebt schwere Vorwürfe gegen die französische Regierung.
- 2024 sei er von Paris dazu gedrängt worden, vor der Präsidentschaftswahl in Moldau bestimmte Telegram-Kanäle zu zensieren.
- Ähnliches sei zuvor bei der Wahl in Rumänien passiert.
- Durow warnt vor der Bedrohung der Meinungsfreiheit in Europa mit dem Digital Services Act.
Pawel Durow, Gründer und CEO von Telegram, wirft der französischen Regierung seit Kurzem vor, ihn aufgefordert zu haben, bestimmte Kanäle des Messagingdienstes vor der moldauischen Präsidentschaftswahl 2024 zu löschen. Das französische Außenministerium bestreitet die Vorwürfe.
Sowohl Paris als auch Moskau üben auf den Telegram-Gründer Druck aus. Dieser betont die politische Neutralität seiner Plattform. Die verschlüsselte App sei ein Raum des freien Austauschs ohne staatliche Einmischung.
Im August 2024 wurde Durow bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen und nach vier Tagen gegen Kaution freigelassen. Die französische Justiz wirft ihm vor, zu wenig gegen kriminelle Aktivitäten auf Telegram vorzugehen und nicht mit den Behörden zu kooperieren. Zudem würden Beiträge von Nutzern nicht ausreichend moderiert. Die Ermittlungen gegen Durow laufen noch.
Meinungsfreiheit vs. Justizbeeinflussung
Die Vorwürfe gegen Paris erhob Durow am Sonntag, 28. September, als die Bürger von Moldau gerade ein neues Parlament wählten. In einer Nachricht auf X schrieb der 40-jährige Unternehmer:
„Vor etwa einem Jahr, als ich in Paris festsaß, wandten sich die französischen Geheimdienste über einen Mittelsmann an mich und baten mich, der moldauischen Regierung dabei zu helfen, bestimmte Telegram-Kanäle vor den Präsidentschaftswahlen in Moldau zu zensieren.“
Einige der Kanäle auf der Liste verstießen tatsächlich gegen die Regeln der Plattform und seien gelöscht worden.
Durow schrieb weiter, ihm sei im Gegenzug versprochen worden, dass sich der französische Geheimdienst positiv gegenüber dem Richter äußern würde, der seine Verhaftung angeordnet hatte. Dies bezeichnete er als inakzeptabel und – falls wahr – als einen Versuch, das Justizverfahren zu beeinflussen.
Anderenfalls – falls der Geheimdienst nur so tat – „hätte er meine juristische Lage in Frankreich ausgenutzt, um die politische Entwicklung in Osteuropa zu beeinflussen – ein Muster, das wir auch in Rumänien beobachtet haben“.
[etd-related posts=“5260202,5229299,“]
Der Fall verschärfte sich, als ihm eine zweite Liste moldauischer Kanäle vorgelegt wurde. „Im Gegensatz zur ersten Liste waren fast alle diese Kanäle legitim und entsprachen unseren Regeln. Ihre einzige Gemeinsamkeit war, dass sie politische Positionen vertraten, die den Regierungen Frankreichs und Moldaus missfielen. Wir haben uns geweigert, dieser Aufforderung nachzukommen.“
Seine Nachricht verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und löste zahllose Reaktionen aus. Darunter ist auch eine von Elon Musk, der ein „Wow“ hinterließ.
Das französische Außenministerium postete zu den aktuellen Anschuldigungen am 28. September auf X: „Pawel Durow erhebt gern Anschuldigungen, wenn Wahlen stattfinden. Nach Rumänien nun Moldau.“
Geschah Ähnliches bei der rumänischen Wahl?
Denn es ist nicht das erste Mal, dass Durow Paris der Einmischung in eine Wahl bezichtigt. Am 18. Mai 2025, als die zweite Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen stattfand, behauptete er, die französische Regierung habe versucht, ihn zu überzeugen, „die konservativen Stimmen“ des Landes zum Schweigen zu bringen.
Dabei fiel auch der Name von Nicolas Lerner, dem Direktor der DGSE. Die DGSE ist der französische Auslandsnachrichtendienst, vergleichbar mit dem BND. Der Dienst wies die Vorwürfe „mit Nachdruck“ zurück.
„Wir haben diejenigen, die in Russland, Belarus oder im Iran protestiert haben, nicht blockiert. Wir werden dies auch in Europa nicht tun“, schrieb Durow damals auf X.
[etd-related posts=“4899209″]
Kreml: „Soziale Netzwerke sollen Werkzeuge der Regierung sein“
Durow betonte von Anfang an politische Neutralität. 2006 gründete er VKontakte in Russland. VK gilt als „russisches Facebook“. 2013 rief er Telegram ins Leben.
2012, als er noch VK leitete, gewann er die Sympathie der russischen Opposition, da er sich weigerte, Konten von Gruppen zu löschen, die Anti-Putin-Proteste koordinierten. 2014 wurde er durch den Druck des Kremls gezwungen, seine Unternehmensanteile abzugeben und Russland zu verlassen. Im Juni 2024 sagte Durow in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Le Point“:
„Ein hochrangiger russischer Beamter bestand darauf, dass soziale Netzwerke seiner Meinung nach Werkzeuge der Regierung sein sollten.“
Durow weiter: „Ich hatte damals zwei Optionen: Entweder ich tat genau das, was die russischen Behörden von mir erwarteten, oder ich verkaufte meine Unternehmensanteile und verließ das Land.“
Diese Neutralität, so Durow, werde oft als eine eigenständige Position wahrgenommen. „In Russland sagt man, Telegram unterstütze die Ukraine. In der Ukraine sagt man, Telegram verbreite russische Propaganda. In Wirklichkeit haben wir eine Pflicht zur Neutralität.“
[etd-related posts=“4842044,4756189,“]
Telegram sei eine Plattform, auf der gegensätzliche Ideen aufeinandertreffen könnten, jeder Zugang zu verschiedenen Sichtweisen habe und frei entscheiden könne, was er glauben wolle.
„Ich werde niemals meine Meinung zu einem geopolitischen Konflikt äußern, denn das würde sofort als Unterstützung für eine Seite gewertet werden. Eine neutrale Plattform muss ein unparteiischer Schiedsrichter bleiben, der für alle die gleichen Regeln anwendet.“
Russlands staatliche App Max
In Russland versuchte der Kreml zwischen 2018 und 2020 erfolglos, Telegram zu blockieren. Nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 verbot Moskau Facebook, Instagram und deren Muttergesellschaft Meta wegen „extremistischer“ Aktivitäten. Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein Gesetz, das die Verbreitung „falscher Informationen“ über den Krieg in der Ukraine mit Geldstrafen und Gefängnis ahndet.
Im Sommer 2025 schränkten die russischen Behörden zudem Telefonanrufe über WhatsApp und Telegram ein. Parallel dazu stellte die russische Regierung ihre eigene nationale Messenger-App namens Max vor, die auf Anordnung von Putin entwickelt wurde. Die App, die inzwischen standardmäßig auf allen in Russland verkauften Smartphones und Tablets installiert ist, bietet jedoch keine End-to-End-Verschlüsselung.
Putin unterzeichnete auch ein Gesetz, das die Onlinesuche nach „extremistischen“ Inhalten unter Strafe stellt. Der Begriff ist in der russischen Gesetzgebung sehr weit gefasst. Verboten ist unter anderem auch Werbung für VPNs.
Haftet ein Messerhersteller dafür, wenn jemand mit seinem Messer einen anderen angreift?
Während Telegram regelmäßig vom Kreml angegriffen wird, steht Durow immer noch im Fokus der französischen Behörden. Die Ermittlungen gegen ihn laufen noch. Der russische Milliardär besitzt auch die französische Staatsbürgerschaft. Er ist verpflichtet, seit August 2024 alle 14 Tage nach Frankreich zurückzukehren.
Durow wurde unter anderem wegen Beihilfe zur Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten, Drogenhandel und bandenmäßigem Betrug angeklagt – ein Verfahren, das er als „absurd“ bezeichnet.
„Nur weil Kriminelle unseren Messenger benutzen – wie viele andere auch –, macht uns das noch lange nicht zu Kriminellen.“
Der Unternehmer zeigt sich besorgt über den Rückgang der Meinungsfreiheit in Europa. Aus seiner Sicht sind Gesetze wie der Digital Services Act „gefährliche“ Instrumente, denn „wenn man Zensur erst einmal legitimiert hat, ist es sehr schwer, wieder davon wegzukommen“.
Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „«Après la Roumanie, la Moldavie» : Pavel Durov accuse la France de lui avoir demandé de censurer des canaux Telegram“.








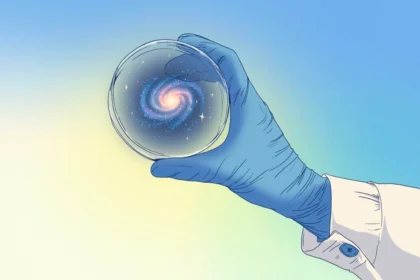







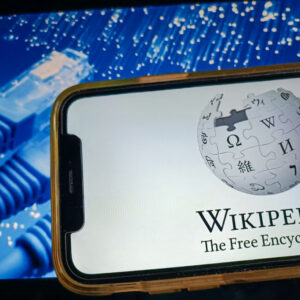








vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion