
Wie sich der „Raubüberfall des Jahrhunderts“ im Louvre abspielte

In Kürze:
- Nach Louvre-Raub gibt es Diskussionen über Sicherheitsvorkehrungen
- Museen sind häufig Ziel spektakulärer Überfälle
- Spezialeinheit ermittelt, doch gibt es wenig Hoffnung auf Erfolg
Als „Raubüberfall des Jahrhunderts“ haben mehrere französische Zeitungen den Diebstahl von Kronjuwelen aus dem Pariser Louvre am Sonntag, 19. Oktober, bezeichnet. Kommentatoren zogen zudem Parallelen zu ähnlichen Verbrechen, die im Laufe der Jahre Schlagzeilen machten.
Mit der Hebebühne ins Obergeschoss
Nach dem Diebstahl am helllichten Tag wurden Fragen zu den Sicherheitsvorkehrungen im meistbesuchten Museum der Welt aufgeworfen. Der Louvre zieht jährlich fast 9 Millionen Besucher an. Nun wird auch darüber spekuliert, wer hinter der Tat stecken könnte. Derweil laufen die Ermittlungen der Fahnder auf Hochtouren.
Laut Staatsanwältin Laure Beccuau ereignete sich der Überfall um 9:30 Uhr Ortszeit – nur eine halbe Stunde, nachdem das Museum geöffnet war. Die mit Sturmhauben getarnten Täter brachen in eine Galerie im Obergeschoss des Museums ein. Sie hielten mit einem Kleinlaster an einer Straße entlang der Seine. Dann kletterten sie über eine ausziehbare Leiter auf der auf dem Wagen montierten Hebebühne und brachen die Fenster des Gebäudes der Galerie d’Apollon mithilfe von Trennschleifern auf. Sie bedrohten die Wachen mit ihren Werkzeugen und stahlen die französischen Kronjuwelen.
„Le Monde“ und andere französische Medien berichteten, dass es sich um vier Diebe handelte. Zwei trugen reflektierende gelbe Westen, die sie wie Bauarbeiter aussehen lassen sollten. Zwei fuhren in dem Lastwagen, während die anderen beiden auf Motorrollern unterwegs waren. Bevor sie mit ihrer Beute auf den Zweirädern flüchteten, versuchten sie, den Kran in Brand zu stecken – allerdings ohne Erfolg. Das Museum wurde nach dem Überfall bis zum Tag darauf geschlossen.
[etd-related posts=“5020959″]
Acht Schmuckstücke erbeutet
Die Unbekannten erbeuteten acht Schmuckstücke. Die Krone von Kaiserin Eugénie, der Frau von Napoleon III., ließen sie bei der Flucht fallen. Den Kopfschmuck zieren 1.354 Diamanten und 56 Smaragde, wie auf der Website des Museums zu lesen ist. Der Präsident des Auktionshauses Drouot, Alexandre Giquello, sagte gegenüber „Reuters“, das Auktionshaus bewerte die Krone auf „mehrere Dutzend Millionen Euro“. Er fügte hinzu, dass sie seiner Meinung nach „nicht der wichtigste Gegenstand“ in der angestrebten Beute sei.
Das französische Kultusministerium veröffentlichte eine Aufstellung mit den Beutestücken:
- ein Saphirdiadem, das den Königinnen Marie-Amélie und Hortense gehörte,
- eine Halskette aus demselben Saphirset,
- ein einzelner Ohrring (ein halbes Paar) aus demselben Set,
- eine Smaragdkette der Kaiserin Marie-Louise, der zweiten Frau von Napoleon I.,
- ein Paar Smaragdohrringe aus demselben Set,
- eine Brosche, die als „Reliquienschrein-Brosche“ bekannt ist,
- ein Diadem der Kaiserin Eugénie, der Ehefrau von Napoleon III.
- und eine große Schleifenbrosche der Kaiserin Eugénie.
Warum die Diebe den Regent, einen der weltweit berühmtesten Diamanten, der laut Sotheby’s mehr als 50 Millionen US-Dollar wert ist, zurückließen, ist derzeit unklar.
Staatsanwältin Beccuau sagte, es werde in alle Richtungen ermittelt. Möglich sei, dass ein Sammler den Raub in Auftrag gegeben habe. Dann bestehe die Möglichkeit, die Beute unversehrt wiederzufinden. Es könne aber auch sein, dass die Täter nur am Geldwert der Juwelen und Edelmetalle interessiert gewesen seien.
Auch bestehe die Möglichkeit, dass der Schmuck zur Geldwäsche von kriminellen Erträgen verwendet werden könnte. „Heutzutage kann alles mit Drogenhandel in Verbindung gebracht werden, wenn man bedenkt, dass mit [diesem Verbrechen] erhebliche Geldsummen erzielt werden.“
Die Ermittlungen leitet eine auf Raubüberfälle spezialisierte Polizeieinheit, die laut Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez eine hohe Aufklärungsquote bei Taten dieser Art aufweist.
Unzureichend gesicherte Museen
Der Raubüberfall hat eine Debatte über die Finanzierung von Museen neu entfacht. Sie sind weit weniger gesichert als Banken, obwohl sie zunehmend im Visier von Dieben stehen. Anfang des Jahres beantragten die Verantwortlichen des Louvre dringend benötigte Mittel von der französischen Regierung, um die alternden Ausstellungssäle des Museums zu restaurieren und zu renovieren und die unzähligen Kunstwerke besser zu schützen.
Macron schrieb auf X im Januar, dass ein neuer Regierungsplan für den Louvre „für mehr Sicherheit sorgt“. Trotz des Versprechens des französischen Präsidenten, die Renovierung im Wert von 700 Millionen Euro durchzuführen, streikten die Mitarbeiter des Museums im Juni wegen der ihrer Meinung nach gefährlichen Überfüllung durch Besucher.
Kulturministerin Rachida Dati sagte am Montag bei einem Besuch am Tatort, dass das Thema Museumssicherheit nicht neu sei. „40 Jahre lang wurde wenig Wert auf die Sicherung dieser großen Museen gelegt, und vor zwei Jahren forderte der Präsident des Louvre eine Sicherheitsüberprüfung beim Polizeipräfekten.“ Museen müssten sich an neue Formen des organisierten Verbrechens anpassen.
Justizminister Gérald Darmanin sagte, das Verbrechen werfe „bedauerliches“ Licht auf Frankreich. Oppositionspolitiker kritisierten die Regierung für das, was sie als nationale Demütigung bezeichneten, in einer Zeit, in der das Land bereits tief in der politischen Krise steckt.
Christopher Marinello, Gründer von Art Recovery International, einer Organisation, die sich auf die Wiederbeschaffung gestohlener Kunst spezialisiert hat, sagte: „Der Louvre ist eines der am finanzstärksten Museen der Welt.“ Der Vorfall zeige, dass „jedes Museum verwundbar ist“.
Frankreich plant nun, den Schutz von Kulturstätten im ganzen Land zu überprüfen und bei Bedarf die Sicherheit zu verstärken, kündigten Regierungsmitarbeiter am Montag an.
Schlagzeilenträchtige Raubüberfälle
Der Louvre war bereits des Öfteren Ziel von Dieben. Einige der schlagzeilenträchtigen Raubüberfälle wurden auch verfilmt. Bei einem der berühmtesten und waghalsigsten Kunstdiebstähle der Geschichte verschwand 1911 das Gemälde der Mona Lisa aus dem Museum. Der Täter war der Handwerker Vincenzo Peruggia. Als ehemaliger Mitarbeiter des Museums verfügte er über detaillierte Kenntnisse über die Sicherheitssysteme.
Der Italiener versteckte sich über Nacht in einem Schrank. Er bewahrte das Kunstwerk zwei Jahre lang in seiner Pariser Wohnung auf und brachte es schließlich nach Italien. Als er es versuchte zu verkaufen, wurde er gefasst und vor Gericht gestellt. Er sagte aus, dass er das Bild an sich genommen habe, um es in seine Heimat zu bringen. Er vertrat die Ansicht, dass das Werk rechtmäßig Italien gehört. Die Strafe fiel mild aus, Peruggia saß nur sieben Monate im Gefängnis.
Der Überfall vom vergangenen Sonntag war der erste bekannte Diebstahl aus dem Louvre seit 1998. Damals stahlen Unbekannte ein Gemälde des französischen Landschafts- und Porträtmalers Camille Corot. Es ist seither nicht wieder aufgetaucht.
Im September brachen Kriminelle in das Pariser Naturhistorische Museum ein. Sie machten sich mit Goldnuggets im Wert von 600.000 Euro aus dem Staub. Ebenfalls im vergangenen Monat stahlen Täter eine Vase und zwei Schalen aus einem Museum in der Innenstadt von Limoges. Die Beute hat einen Wert von 6,5 Millionen Euro.
Vjeran Tomic, der sogenannte französische Spiderman, stahl 2010 fünf nie wiedergefundene Meisterwerke aus dem Pariser Musée d’Art Moderne. Seine Tat bezeichnete er in einem Interview mit „The New Yorker“ als „einen Akt der Phantasie“.
[etd-related posts=“5279414″]
Die meisten Beutestücke tauchen nie wieder auf
Alexandre Giquello, Präsident des Auktionshauses Drouot, bezeichnete die aus dem Louvre gestohlenen Schmuckstücke in ihrer jetzigen Form als „völlig unverkäuflich“. „Im Idealfall erkennen die Täter die Schwere ihres Verbrechens und die Dimension, in die sie eingetreten sind, und geben die Gegenstände zurück“, sagte er.
Hingegen sagte Tobias Kormind, Geschäftsführer des Juwelierhändlers 77 Diamonds: „Es ist unwahrscheinlich, dass wir diese Juwelen jemals wiedersehen.“
Professionelle Täter zerkleinern und schneiden oft große, erkennbare Steine neu. Auf diese Weise entgehen sie der Entdeckung und verwischen die Herkunft ihrer Beute. So ist es weniger riskant, sie auf dem Schmuck- und Metallmarkt anzubieten. Laut internationalen Schätzungen tauchen weniger als 10 Prozent von gestohlenen Kunstwerken jemals wieder auf.
Kryptowährungen könnten eine Rolle beim Verkauf spielen
Es gibt Spekulationen, dass Kryptowährungen eine Rolle bei dem Verbrechen spielen könnten. Der britische Privatdetektiv John Eastham sagte, dass die Ermittler für Kunstverbrechen einen scharfen Schwenk von bargeldbasierter Geldwäsche zu kryptobasierter Liquidität beobachten. Dies passiert hauptsächlich dann, wenn gestohlene Waren nur schwer offen verkauft werden können.
„Wenn Beute einen außergewöhnlichen Wert hat – insbesondere bei Kulturgütern – ist die eigentliche Frage nicht nur, was gestohlen wurde, sondern auch, wie sie zu Geld gemacht wird. Sie können nicht einfach in eine Bank mit Millionen in Noten oder Diamanten gehen. Krypto bietet Geschwindigkeit, Anonymität und internationale Reichweite auf eine Weise, wie es Bargeld nicht mehr kann“, erläuterte Eastham.
„Es ist sehr wahrscheinlich, dass derjenige, der hinter dem Louvre-Diebstahl steckt, bereits einen digitalen Ausstiegsplan hatte – entweder das Einschmelzen von Komponenten und den Verkauf über private Netzwerke oder die Verwendung hochwertiger NFTs (Non-Fungible Tokens) oder Stablecoins, um die Gelder zu waschen.“
Der französische Präsident Emmanuel Macron versprach in einem auf Beitrag X, die Juwelen zurückzuholen und die Täter vor Gericht zu stellen. Macron nannte den Diebstahl „einen Angriff auf ein Erbe, das wir schätzen, weil es unsere Geschichte ist“.
Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How the Louvre ,Heist of the Century’ Unfolded“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung os)








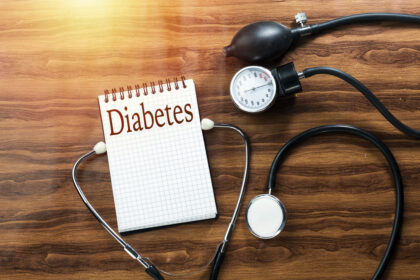





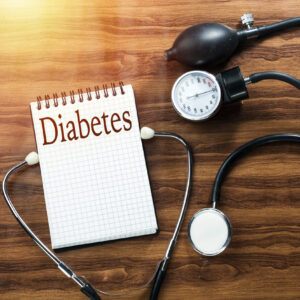










vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion