
Das neue Medienfreiheitsgesetz der EU: Zwischen Pluralismus und politischer Einflussnahme

Am 8. August 2025 ist das neue Medienfreiheitsgesetz der EU nahezu in vollem Umfang in Kraft getreten. Der sogenannte „European Media Freedom Act“ (EMFA) soll hauptsächlich für den „Schutz der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU“ sorgen sowie „den freien Dienstleistungsverkehr“ verbessern, wie die EU-Kommission in ihrer Zusammenfassung schreibt.
In Artikel 1 (1) der Verordnung Nr. 2024/1083 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. April 2024, kürzer: Europäisches Medienfreiheitsgesetz, liest sich der „Gegenstand“ der Beschlussliste wie folgt:
„Mit dieser Verordnung werden — unter Wahrung der Unabhängigkeit und des Pluralismus von Mediendiensten — gemeinsame Vorschriften für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts für Mediendienste festgelegt, und das Europäische Gremium für Mediendienste eingerichtet.“
Eine Ausnahme ist die Crux
Wie aus Artikel 4 (3) der EMFA-Verordnung hervorgeht, sind nationalstaatliche Maßnahmen, die sich gegen den Quellenschutz, gegen die vertrauliche Kommunikation oder gegen die „redaktionelle Freiheit und Unabhängigkeit der Mediendiensteanbieter“ richten, grundsätzlich unzulässig.
Nicht erlaubt sind demnach die Erzwingung von vertraulichen Informationen von Journalisten, Redaktionen oder deren Kontaktpersonen. Behördliche Maßnahmen wie Inhaftierung, Sanktionierung, Überwachung, Durchsuchungen oder Beschlagnahmen, „um Informationen zu erhalten, die mit journalistischen Quellen oder vertraulicher Kommunikation im Zusammenhang stehen oder diese identifizieren können“, sind ebenfalls unzulässig.
Doch das neue Medienfreiheitsgesetz der EU macht eine Ausnahme: Im Artikel 4 (4) c EMFA heißt es, Durchsuchungen und Beschlagnahmen seien „im Einzelfall durch einen überwiegenden Grund des Allgemeininteresses“ unter bestimmten Umständen „gerechtfertigt“ und „verhältnismäßig“.
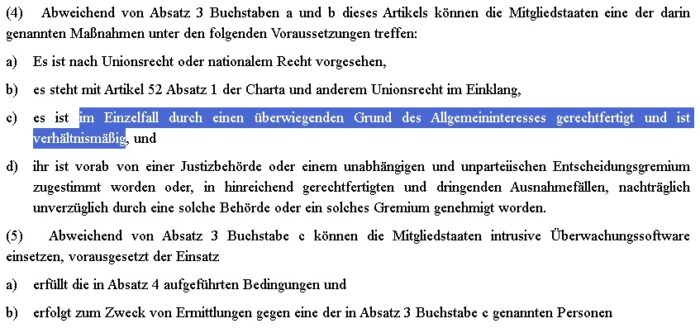
Ein Ausschnitt aus Artikel 4 des „European Media Freedom Act“ (EMFA) zeigt, dass Repressalien gegen Journalisten oder Redaktionen „im Einzelfall durch einen überwiegenden Grund des Allgemeininteresses“ erlaubt sein können. Das genügt aber nicht, um den weitreichenden Schutz für Journalisten in Deutschland auszuhebeln. Foto: Bildschirmfoto/Amtsblatt der Europäischen Union
„Ausführlichere oder strengere Vorschriften“ sind den Mitgliedsstaaten gemäß Artikel 1 (3) zwar erlaubt – aber nur,
sofern diese Vorschriften ein höheres Schutzniveau für Medienpluralismus oder redaktionelle Unabhängigkeit im Einklang mit dieser Verordnung gewährleisten und mit dem Unionsrecht vereinbar sind.“
Genau das ist in Deutschland spätestens seit dem 27. Februar 2007 der Fall. Damals hatte der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) entschieden, dass „Durchsuchungen und Beschlagnahmen in einem Ermittlungsverfahren gegen Presseangehörige […] verfassungsrechtlich unzulässig“ seien, „wenn sie ausschließlich oder vorwiegend dem Zweck dienen, die Person des Informanten zu ermitteln“ (Az.: 1 BvR 538/06, 1 BvR 2045/06, PDF).
„Cicero-Urteil“: Mehr Schutzrechte für Journalisten in Deutschland
Hintergrund war damals eine Verfassungsbeschwerde des Magazins „Cicero“. Das Potsdamer Blatt hatte sich 2005 laut „Jura-online.de“ in Karlsruhe gegen die Durchsuchung von Redaktionsstuben und Privaträumen ihrer Autoren gewehrt. Zuvor hatte die Potsdamer Staatsanwaltschaft beim örtlichen Amtsrichter eine Durchsuchung mit der Begründung durchgesetzt, die „Cicero“-Mitarbeiter könnten sich mit einem Artikel der Beihilfe zur Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig gemacht haben. Doch damit kamen die Ermittler in Karlsruhe nicht durch. In den Leitsätzen des ersten Senats hieß es:
Die bloße Veröffentlichung eines Dienstgeheimnisses im Sinne des § 353 b StGB durch einen Journalisten reicht im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht aus, um einen den strafprozessualen Ermächtigungen zur Durchsuchung und Beschlagnahme genügenden Verdacht der Beihilfe des Journalisten zum Geheimnisverrat zu begründen.“
Die Ausnahmen aus Artikel 4 (4) c EMFA, nach der Durchsuchungen und Beschlagnahmen „im Einzelfall durch einen überwiegenden Grund des Allgemeininteresses“ unter bestimmten Umständen „gerechtfertigt“ und „verhältnismäßig“ sein könnten, greifen also im Fall Deutschlands zu kurz. Denn hier schützt Paragraf 53 (1.5) der Strafprozessordnung (StPO) grundsätzlich das Zeugnisverweigerungsrecht, Paragraf 97 StPO das Beschlagnahmeverbot.
Wie die „Berliner Zeitung“ anmerkt, könnte das Schutzgebot für andere EU-Staaten mit anderer Rechtslage per EMFA allerdings „faktisch ausgehöhlt werden“, auch wenn die Mindestschutzstandards für Medienanbieter in der EU nun eigentlich erweitert wurden.

Ein Zeitungskiosk in Paris. Das neue Medienfreiheitsgesetz gilt in der gesamten EU. Doch in Staaten, die die Unabhängigkeit von Medien nicht über weiterreichende nationale Rechtsprechung schützen, kann durch den EMFA politische Einflussnahme sogar steigen. Foto: BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images
Überwachungssoftware schon heute in engen Grenzen erlaubt
Dass der EMFA in Artikel 4 (5) unter bestimmten Umständen ausnahmsweise auch „intrusive Überwachungssoftware“ gegen Journalisten erlaubt, widerspricht deutschem Recht gemäß der Paragrafen 100c bis 100f StPO ebenfalls nicht.
Solche Ausspähattacken dürfen hierzulande aber nur bei Vorliegen oder – in besonders dringenden Fällen – beim Nachreichen einer richterlichen Entscheidung und aufgrund von möglicherweise gefängnisbewehrten Straftaten erfolgen.
Das EU-Verordnungswerk meint damit unter anderem Straftaten aus Artikel 2 (2) des EU-Rats-Rahmenbeschlusses 2002/584/JI über Europäische Haftbefehle, also Verbrechen wie Drogenhandel, Autohehlerei, Geldfälscherei, Terrorismus, Menschenhandel, Kinderpornografie oder Mord, aber auch einfache Betrugsdelikte, Umweltkriminalität oder schlicht „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“.
Bekenntnis zum ÖRR: Mehr Unabhängigkeit, aber auch mehr Transparenz
Laut Artikel 5 EMFA müssen die öffentlich-rechtlichen Anbieter (ÖRR) „redaktionell und funktional unabhängig“ sein und „auf unparteiische Weise eine Vielzahl von Informationen und Meinungen bieten“.
Entsprechend muss das „Verfahren für die Ernennung und die Entlassung des Geschäftsführers oder der Mitglieder des geschäftsführenden Gremiums“ dem Aspekt der Unabhängigkeit Priorität einräumen. Die Auswahl der jeweiligen Verantwortlichen muss nach „transparenten, offenen, wirksamen und nichtdiskriminierenden“ Kriterien erfolgen. Dieselben Maßstäbe gelten für vorzeitige Entlassungen von Führungskräften, wobei die Gründe einer gerichtlichen Überprüfung genügen müssen.
„Transparente und objektive“ Maßstäbe müssen nach Artikel 5 (3) vorab auch bei ÖRR-Finanzierungsverfahren sichergestellt werden. Am Ende muss in jedem Fall genug verlässliches Geld für den ÖRR fließen, um dessen „Unabhängigkeit“ zu wahren. Auch die Kontrollbehörden oder -mechanismen in den einzelnen EU-Staaten müssen regierungsunabhängig arbeiten und ihre Beobachtungsergebnisse offenlegen.
Offenlegungspflichten für Medien-Eigentümer
Die „Mediendiensteanbieter“ selbst müssen sich gemäß Artikel 6 ebenfalls in die Karten schauen lassen und mehr Bürokratie erledigen. Zu veröffentlichen sind nicht nur die Namen des oder der Eigentümer eines Medienhauses, sondern auch dessen beziehungsweise deren genaue Beteiligungen, „die es ihm/ihnen ermöglichen, Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und die strategische Entscheidungsfindung auszuüben“.
Auch das Ausmaß der Einnahmen aus staatlicher Werbung sowie „von Behörden oder öffentlichen Stellen aus Drittländern“ ist von den Mediendienstanbietern auszuweisen. Den Regulierungsbehörden in den EU-Staaten obliegt sodann die Pflicht, „nationale Datenbanken zum Medieneigentum“ öffentlich zu machen. Bei all dem sollen etwaige Interessenkonflikte leichter zu erkennen sein.
Artikel 26 schreibt andauernde Beobachtungspflichten im „Binnenmarkt für Mediendienste“ hinsichtlich der Zuweisung öffentlicher Mittel für staatliche Werbung fest. Außerdem verpflichtet sich die EU-Kommission, sicherzustellen, dass sie fortwährend ein Auge auf Medienkonzentrationen, auf „ausländische Informationsmanipulation und Einmischung“ und auf Risiken „für den Medienpluralismus und die redaktionelle Unabhängigkeit“ richtet.
Neues „Europäisches Gremium für Mediendienste“
Hatte sich bisher die „Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA)“ EU-weit um Interessenkonflikte gekümmert, so sollen Kommunikation, Schlichtung und Überwachung laut Artikel 8 und 9 künftig über ein neues, „völlig unabhängiges“ „Europäisches Gremium für Mediendienste“ erfolgen.
Im Widerspruch zu einem vollständig unabhängigem Gremium heißt es allerdings weiter in Artikel 9: Das neue Gremium lasse „die Zuständigkeiten der Kommission oder der nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen gemäß dieser Verordnung unberührt.“
Die EU-Kommission beharrte gemäß Artikel 10 zudem auf einem eigenen Platz im Gremium. Der beinhaltet aber kein Abstimmungsrecht, sondern soll nur „beratend“ zur Seite stehen. Der Rest der Runde besteht aus jeweils einem stimmberechtigten Vertreter der „nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen“, die aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden nebst Stellvertreter wählen. Diese Gremiumsspitze darf maximal zwei Jahre im Amt bleiben.
Das gesamte Gremium darf auf die „administrative“, „organisatorische“ und „inhaltliche“ Hilfe eines „Sekretariats“ zurückgreifen, das wiederum von der EU-Kommission gestellt wird. Umgekehrt muss das Gremium laut Artikel 13 gegenüber der Kommission eine Reihe von Informations- und Vermittlungspflichten erfüllen.
Laut Artikel 19 muss das Gremium zudem „regelmäßig einen strukturierten Dialog zwischen Anbietern sehr großer Online-Plattformen [wie Facebook, X oder Instagram, Anmerkung der Redaktion] sowie Vertretern von Mediendiensteanbietern und der Zivilgesellschaft“ organisieren. Wer mit „Zivilgesellschaft“ gemeint ist, bleibt im Vagen.
Klar ist jedoch, dass ausdrücklich auch die „Einhaltung von Selbstregulierungsinitiativen zum Schutz der Nutzer vor schädlichen Inhalten, einschließlich Desinformation sowie der ausländischen Informationsmanipulation und Einmischung im Informationsraum“ eine Rolle spielen muss.
[etd-related posts=“5212285,5113807,4319911″]
Hoffen auf weniger Lösch-Streitigkeiten
Die „sehr großen Onlineplattformen“ müssen ihre Beziehung zu Mediendiensteanbietern gemäß Artikel 18 und im Geiste des „Digital Services Act“ (DSA) weiter intensivieren.
Bevor ein Player wie YouTube oder Facebook Medieninhalte nicht wegen EU-Vorschriften, sondern nur auf Grundlage seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen als „unvereinbar“ ansieht und daher einschränken oder löschen will, muss er dies dem Inhaltsgeber zuvor anzeigen und begründen. Wehrt sich das Medienhaus dagegen, muss die Onlineplattform „vorrangig und unverzüglich“ darüber entscheiden. Dabei hat die Plattform im Dialog eine möglichst „gütliche Lösung“ anzustreben.
Der Mediendiensteanbieter darf auch das neue EU-Gremium bitten, Hilfe zu einem Streitfall zu leisten, oder versuchen, die Sache nach EU-Recht per Mediation oder außergerichtlichem Streitbeilegungsverfahren zu klären. Die „sehr großen Onlineplattformen“ haben laut Artikel 18 (8) einmal im Jahr Informationen über ihre Beschränkungs- und Löschaktivitäten zu veröffentlichen.
Das Verordnungswerk schließt mit dem Satz: „Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem behördlichen Verfahren.“






















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion