
Brechts Kinderhymne als Gegenentwurf zur deutschen Nationalhymne

Bertolt Brecht statt Hoffmann von Fallersleben – wenn es nach Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) geht, sollte es bald eine neue deutsche Nationalhymne geben. Auch will der frühere Ministerpräsident Thüringens über die aktuelle schwarz-rot-goldfarbene Landesflagge abstimmen lassen (Epoch Times berichtete). Er selbst singe die aktuelle Hymne zwar „mit Begeisterung“, doch kenne er viele Ostdeutsche, die „die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen“.
Wunsch nach nationaler Einheit und Freiheit
Die aktuelle Nationalhymne bestand ursprünglich aus drei Strophen. Der Text stammte von dem Dichter August Heinrich Hoffmann, besser bekannt unter dem Namen Hoffmann von Fallersleben (1798–1874). Er schrieb die Zeilen 1841 auf Helgoland. Die Insel stand damals noch unter britischer Verwaltung.
So spiegelt der Text den Wunsch nach nationaler Einheit und Freiheit für die deutschen Länder, die zu jener Zeit noch zersplittert waren, wider. Für die Vertonung wählte der Dichter ein Werk von Joseph Haydn (1732–1809). Der österreichische Komponist schuf es 1797 als Hymne für den österreichischen Kaiser („Gott erhalte Franz den Kaiser“).
Schon vor der Entstehung der Nationalhymne galt Hoffmann von Fallersleben als unbequemer Kritiker der preußischen Obrigkeit. Seine politischen Texte brachten ihm zunächst den Verlust seiner staatlichen Anstellung ein. Wenig später wurde er ins Exil gedrängt, schreibt die Konrad-Adenauer-Stiftung in einem Beitrag zur Geschichte der Hymne auf ihrer Internetseite.
[etd-related posts=“5187591″]
Trotz der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871 blieb die Frage nach einer einheitlichen Nationalhymne ungelöst – nicht zuletzt aufgrund des föderalen Staatsaufbaus. Während in Preußen sowie bei offiziellen und patriotischen Feierlichkeiten häufig die Kaiserhymne „Heil Dir im Siegerkranz“ erklang, bevorzugten andere Regionen des Reiches Lieder wie „Die Wacht am Rhein“ oder ähnliche patriotische Gesänge.
Erst gegen Ende des Ersten Weltkriegs gewann das Deutschlandlied zunehmend an Popularität. Im Jahr 1922 erklärte Reichspräsident Friedrich Ebert es schließlich zur offiziellen Nationalhymne der Weimarer Republik.
Hymne blieb trotz Verbots populär
Während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland (1933–1945) wurde die erste Strophe („Deutschland, Deutschland über alles […]“) von Fallerslebens Werk mit dem Horst-Wessel-Lied kombiniert.
1945 wurde das Lied in der amerikanischen Besatzungszone vorläufig verboten. Im nun geteilten Deutschland blieb das Deutschlandlied weiterhin populär. Der Versuch von Bundespräsident Theodor Heuss (FDP, 1884–1963), dem Volk eine neue Nationalhymne zu präsentieren, schlug fehl. Der Dichter Rudolf Alexander Schröder (1878–1962) komponierte auf Heuss’ Wunsch hin zwar ein Werk, das bei der Bevölkerung allerdings auf wenig Zustimmung stieß.
So setzte Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU, 1876–1967) schließlich ein deutliches Zeichen: Bei einer Pressekonferenz im April desselben Jahres in Berlin forderte er die Anwesenden auf, sich zu erheben und die dritte Strophe des Deutschlandliedes zu singen.
Damit schuf er Fakten, die sich nicht mehr ignorieren ließen. Offiziell wurde das Deutschlandlied dann 1952 wieder Nationalhymne, allerdings bestand es indessen nur noch aus der dritten Strophe. Auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands entflammte eine neue Diskussion um die Hymne. Auch dieses Mal setzte sich Hoffmann von Fallerslebens Fassung durch. Seit 1991 ist sie wieder die offizielle Nationalhymne.
Die dritte Strophe, die mit den Worten „Einigkeit und Recht und Freiheit“ beginnt, „spiegelt die Werte wider, derer sich die Bundesrepublik heute verpflichtet fühlt und welche in Artikel 1 bis 19 im Grundgesetz verankert sind“, schreibt die Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrem Beitrag abschließend.
Brechts Kinderhymne als Gegenentwurf
Die jetzt von Ramelow ins Gespräch gebrachte Alternative zum Deutschlandlied ist die Kinderhymne von Bertolt Brecht (1898–1956). Das Gedicht schrieb er 1950. Es war als alternativer Entwurf für die Nationalhymne gedacht.
Sie entstand als direkte Reaktion auf die politische Entscheidung, die dritte Strophe des Deutschlandliedes zur offiziellen Hymne der Bundesrepublik zu erklären – ein Schritt, den Brecht kritisch betrachtete. Die Verse vertonte Brechts künstlerischer und politischer Weggefährte Hanns Eisler (1898–1962). Er war – wie Haydn – Österreicher.
Nach der Wiedervereinigung setzten sich 1990 neben Bürgerinitiativen auch einige Künstler dafür ein, dass Brechts Werk die gesamtdeutsche Nationalhymne werden sollte.
Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit je vier Versen. In einer Interpretation heißt es, dass die Kinderhymne für Völkerverständigung und Gleichstellung, aber dennoch nicht gegen Patriotismus sei.
Auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) kommentiert der Politikwissenschaftler Iring Fetscher (1922–2014) Brechts Gedicht. Er nennt es „das schönste Deutschlandlied, das ich kenne“. Es gebe keine Hymne, „die die Liebe zum eigenen Land so schön, so rational, so kritisch begründet, und keine, die mit so versöhnlichen Zeilen endet“.
Die erste Flagge in Schwarz-Rot-Gold gab es um 1820
Der Ursprung der schwarz-rot-goldenen Nationalflagge, die Ramelow nun ebenfalls zur Disposition stellt, geht auf die Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon (1813–1815) zurück. Das Lützowsche Freikorps, eine Freiwilligeneinheit, trug schwarze Uniformen mit roten Aufschlägen und goldenen Knöpfen – diese Kombination wurde später symbolisch aufgeladen.
Die Jenaer Urburschenschaft übernahm diese Farben als Zeichen für Einheit und Freiheit. Bereits um 1820 führten die Fürstentümer Reuß (ältere und jüngere Linie) im heutigen Thüringen als erste offiziell eine schwarz-rot-gold gestreifte Flagge ein, nachdem sie 1815 dem Deutschen Bund beigetreten waren.
[etd-related posts=“5172484″]
Als Symbol für ein vereintes Deutschland nahm die Frankfurter Nationalversammlung die Farben im Jahr 1848 an. Sie nannte die Flagge „Trikolore“ – in Anlehnung an die Französische Revolution. Im Deutschen Kaiserreich (1871–1918) war die Fahne schwarz-weiß-rot – ein Symbol monarchischer Macht. Nach dem Ersten Weltkrieg führte die Weimarer Republik (1919–1933) als Zeichen demokratischer Erneuerung wieder Schwarz-Rot-Gold ein.
Die Nationalsozialisten ersetzten die traditionelle deutsche Flagge während ihrer Herrschaft (1933–1945) durch die Hakenkreuzfahne. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Teilung Deutschlands wandelte sich auch die Bedeutung der Nationalfarben.
In der Bundesrepublik Deutschland kehrte man zu Schwarz-Rot-Gold zurück – schlicht und ohne Emblem. Die Farben standen nun für den demokratischen Neuanfang im Westen. In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hingegen wurde die Trikolore um Hammer, Zirkel und Ährenkranz ergänzt, um die sozialistische Ausrichtung des Staates zu unterstreichen.
Mit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurde Schwarz-Rot-Gold zur alleinigen Nationalflagge des vereinten Deutschland. Heute steht sie als kraftvolles Symbol für Einheit, Freiheit und die demokratischen Werte, auf denen die Bundesrepublik gegründet ist.




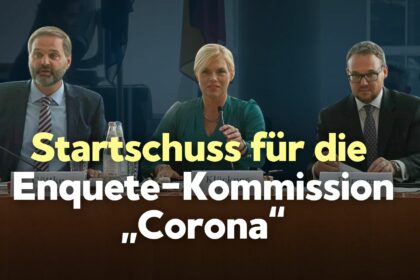

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion