
Das steckt im neuen Steuerpaket – und so sollen Bürger entlastet werden
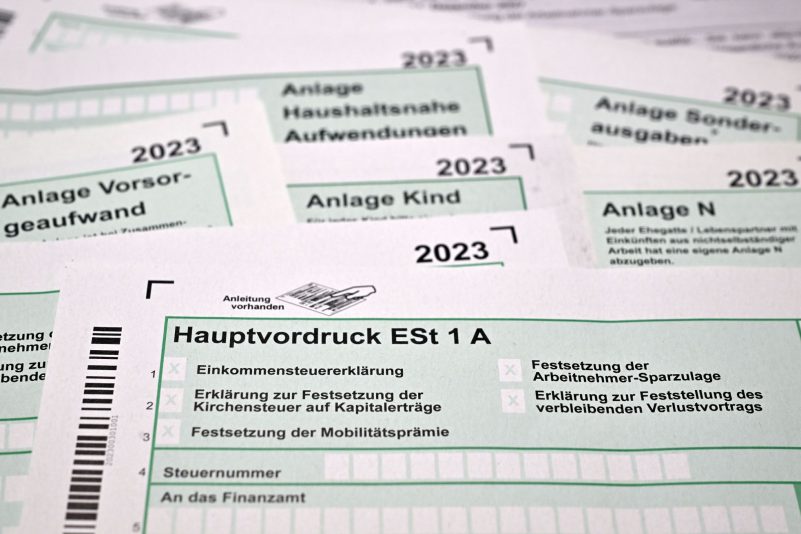
In Kürze:
- Bundesregierung beschließt Steuerpaket.
- Die Mehrwertsteuer auf Speisen sinkt ab 2026.
- Freibeträge sollen steigen, um freiwilliges Engagement attraktiver zu machen.
- Bürger sollen so im Alltag entlastet werden.
Mehr Geld im Portemonnaie, günstigere Restaurantbesuche und Entlastung für lange Arbeitswege – das verspricht das neue Steuerpaket der Bundesregierung. Mit der Erhöhung der Pendlerpauschale, der dauerhaften Mobilitätsprämie und der Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen will die Regierung vorwiegend diejenigen entlasten, die von steigenden Lebenshaltungskosten besonders betroffen sind. In einer Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums heißt es dazu:
„Ziel ist, möglichst breit dort weiter zu entlasten, wo die Krisen der vergangenen Jahre – die Corona-Pandemie oder steigende Energiekosten und Inflation – die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger erhöht haben.“
Schon ab 2026 können Arbeitnehmer mehrere Hundert Euro im Jahr sparen, während Familien und Pendler zugleich von sinkenden Preisen im Alltag profitieren sollen. Doch was bedeutet das konkret? Wie profitieren die Bürger von den Änderungen?
[etd-related posts=“5241383″]
Ab Januar 2026 soll die Entfernungspauschale einheitlich auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer erhöht werden. Bisher gilt dieser Satz erst ab dem 21. Entfernungskilometer. Für kürzere Arbeitswege liegt die Pauschale im Moment bei 30 Cent pro Kilometer.
Bisher profitieren Arbeitnehmer mit langen Wegen besonders
Die Entfernungspauschale – oft auch Pendlerpauschale genannt – ist eine steuerliche Regelung, mit der Arbeitnehmer ihre Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz von der Steuer absetzen können.
Das Prinzip: Für jeden Arbeitstag und jeden einfachen Weg zur Arbeitsstelle kann die Pauschale in der Steuererklärung geltend gemacht werden – unabhängig davon, ob jemand mit dem Auto, der Bahn, dem Fahrrad oder sogar zu Fuß unterwegs ist. Entscheidend ist nur die einfache Strecke, nicht die tatsächliche Zahl der gefahrenen Kilometer am Tag.
So können Beschäftigte ihre steuerliche Belastung senken: Wer weiter pendelt, macht mehr Werbungskosten geltend und zahlt dadurch weniger Einkommensteuer. Besonders profitieren also Arbeitnehmer mit langen Arbeitswegen oder Beschäftigte, die jeden Tag ins Büro fahren müssen.
[etd-related posts=“5214396″]
Maximal absetzbar sind grundsätzlich 4.500 Euro jährlich. Höhere Kosten werden nur bei der Nutzung des eigenen Autos für den Arbeitsweg anerkannt. Wer im Jahr mehr als 15.000 Kilometer Wegstrecke zurücklegt, muss erfahrungsgemäß dem Finanzamt entsprechende Vorlagen von Belegen vorlegen. An diesen Regelungen soll sich auch in Zukunft nichts ändern.
„Mit der Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer schaffen wir mehr Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land. Menschen, die hart arbeiten und weite Wege haben zwischen ihrem Zuhause und ihrem Job, werden spürbar entlastet. Das ist gerade für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen wichtig“, lässt sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in einer Pressemitteilung zitieren.
Entlastung bis zu 1,9 Milliarden Euro
Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums werden die Bürger mit dieser Maßnahme im kommenden Jahr um etwa 1,1 Milliarden Euro entlastet. 2027 sollen es sogar 1,9 Milliarden Euro sein. Das Ministerium begründet den Anstieg im Jahr 2027 damit, dass die Mobilitätsprämie für geringe Einkünfte auch über 2026 hinaus gelten soll.
Diese Prämie richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen, die selbst kaum oder gar keine Steuern zahlen, aber trotzdem Anspruch auf einen Ausgleich für ihre Fahrtkosten haben. Ursprünglich war diese Förderung bis 2026 befristet, nun soll sie dauerhaft gelten. Das bedeutet: Auch nach 2026 bekommen Steuerzahler mit niedrigen Einkommen weiterhin einen finanziellen Zuschuss für ihre Pendelstrecken.
[etd-related posts=“5204870 „]
Nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums wären bei einem Arbeitsweg von 10 Kilometern und einer 5-Tage-Woche 176 Euro an jährlich zusätzlichen Werbungskosten absetzbar. Bei 20 Kilometern sollen es laut Finanzministerium 352 Euro zusätzlich absetzbare Werbungskosten sein. Selbst wer lediglich täglich 5 Kilometer zu seinem Arbeitsort zurücklegen muss, kann noch 88 Euro jährlich als Werbekosten bei der Einkommensteuererklärung absetzen.
Voraussetzung ist bei allen diesen Rechenmodellen allerdings, dass die übrigen Werbungskosten bereits den Arbeitnehmerpauschalbetrag von derzeit 1.230 Euro überschreiten. Nur dann wirkt sich die Entfernungspauschale steuermindernd aus.
Ehrenamt soll attraktiver gemacht werden
Auch das Ehrenamt profitiert von den neuen Steuerregeln: Die Übungsleiterpauschale steigt von 3.000 auf 3.300 Euro, die Ehrenamtspauschale von 840 auf 960 Euro jährlich. Wer also etwa als Trainer im Fußballverein, als Chorleiterin, als Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz oder als Betreuer bei den Pfadfindern aktiv ist, kann künftig mehr steuerfrei behalten. Damit plant die Bundesregierung, freiwilliges Engagement attraktiver zu machen und zugleich das Gemeinnützigkeitsrecht zu vereinfachen.
[etd-related posts=“5147740″]
In einer Pressemitteilung erklärt Klingbeil, Millionen Menschen hielten mit ihrem Ehrenamt die Gesellschaft zusammen. Dieses Engagement wolle die Bundesregierung stärker unterstützen, daher würden die Freibeträge für Übungsleiter erhöht und bürokratische Hürden für Vereine abgebaut, um das Ehrenamt im Sport, in der Kultur und in anderen Bereichen zu stärken.
Gastronomie soll gestärkt und Preise sollen gesenkt werden
Lange hatte vor allem der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) für sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie gekämpft. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf Speisen in Restaurants wurde 2020 als Corona-Hilfsmaßnahme eingeführt, um die Gastronomie in der Krise zu stützen. Ursprünglich war er befristet und wurde mehrfach verlängert, zuletzt bis Ende 2023. Seit dem 1. Januar 2024 gilt nun wieder der reguläre Satz von 19 Prozent. Für Getränke galt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz nie.
Der Branchenverband DEHOGA forderte schon damals die Beibehaltung der 7 Prozent, weil viele Betriebe nach Pandemie, Energiekrise und steigenden Personalkosten finanziell angeschlagen waren. Die Rückkehr zu 19 Prozent, so die Befürchtung, verschärfe die Lage in der Gastronomie und führe zu höheren Preisen für Gäste sowie zu mehr Betriebsschließungen. Die Ampelregierung hörte damals allerdings nicht auf die Argumente der Branche.
Das deutsche Gastgewerbe steckt bis heute tief in der Krise: Auf der DEHOGA-Pressekonferenz Anfang September in Berlin gab der Verband an, dass das Gastgewerbe nach vorläufigen Ergebnissen im ersten Halbjahr dieses Jahres real 15,1 Prozent weniger umsetzt als im Jahr 2019, einem Jahr vor der Corona-Krise. Der Branchenverband beruft sich nach eigenen Angaben dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Dieses hatte im August gemeldet, dass der Umsatz im Gastgewerbe im ersten Halbjahr 2025 im Vorjahresvergleich real um 3,7 Prozent gesunken sei.
Betriebe an der Grenze ihrer Existenz
Laut einer DEHOGA-Umfrage kämpfen fast 40 Prozent der Betriebe mit Verlusten, viele sehen sich durch steigende Kosten und zurückhaltende Gäste an der Grenze ihrer Existenz.
Verbandspräsident Guido Zöllick forderte deshalb auf der Pressekonferenz eine rasche gesetzliche Festschreibung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7 Prozent auf Speisen – spätestens ab Januar 2026. Nur so ließen sich Arbeitsplätze sichern, Investitionen ermöglichen und faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Lieferdiensten und Lebensmitteleinzelhandel schaffen. Die 7-Prozent-Regelung sei, so Zöllick, „überlebenswichtig“ für Restaurants, Cafés und Hotels in Deutschland.

Umsatzentwicklung im Gastgewerbe real (Veränderung gegenüber 2019 in Prozent). Foto: DEHOGA 7/2025; Quelle: Destatis (20.08.25)
Die Bundesregierung hat nun beschlossen, den Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen ab 2026 von 19 auf 7 Prozent herabzusenken. Von der Steuersenkung profitieren nicht nur Restaurants, sondern auch Bäckereien, Metzgereien, der Lebensmitteleinzelhandel sowie Caterer und Anbieter von Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung. Das Finanzministerium erwartet, dass mit dieser Maßnahme die Gastronomiebranche und die Bürger um 3,6 Milliarden Euro jährlich entlastet werden.
Preissenkungen: Eine Frage des Könnens
Anders als die Bundesregierung sagt, sollten die Gäste allerdings eher nicht damit rechnen, dass der Restaurantbesuche ab dem nächsten Jahr wieder billiger wird. Ein Rechenbeispiel soll zeigen, welchen finanziellen Spielraum die gesenkte Mehrwertsteuer im kommenden Jahr schafft: Ein Schnitzel kostet in der Schweriner Innenstadt rund 24 Euro. Verkauft ein Restaurant pro Monat 700 Schnitzel, nimmt es derzeit 16.800 Euro ein. Der Inhaber zahlt davon derzeit 3.192 Euro Mehrwertsteuer. Ab dem kommenden Jahr sind es dann 1.176 Euro. Dem Betreiber des Restaurants bleiben folglich 2.016 Euro mehr in seiner Tasche. Er könnte diese für Investitionen nutzen oder an die Kunden weitergeben. Wenn er sich für die letztere Variante entscheidet, müsste er das Schnitzel um die 2 Euro billiger machen.
Wenn ein Lokal mit seinen Speisen im Jahr einen angenommenen Umsatz von 500.000 Euro macht, kann es mit der Absenkung des Mehrwertsteuersatzes rund 60.000 Euro mehr freisetzen als in diesem Jahr. Eine aktuelle Umfrage der DEHOGA gibt Aufschluss darüber, was zukünftig zu erwarten ist.
[etd-related posts=“4375019″]
So erwarten mehr als drei Viertel der Unternehmen (76,2 Prozent) eine Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Lage. 59,1 Prozent sehen darin die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu sichern oder neu zu schaffen. Ähnlich viele Betriebe (58,6 Prozent) planen, verstärkt in Modernisierung, Digitalisierung und den Ausbau ihrer Kapazitäten zu investieren.
Über die Hälfte (52,6 Prozent) rechnet zudem mit zusätzlichen Spielräumen für Innovationen, während knapp jeder zweite Unternehmer (47,9 Prozent) von einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ausgeht. 44,1 Prozent der Gastronomen wollen die Steuerentlastung nutzen, um ihren Gästen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.
„Preissenkungen sind keine Frage des Wollens, sondern des Könnens“, so DEHOGA-Präsident Zöllick auf der Pressekonferenz. Er verwies dabei auf die angespannte Kostensituation.
Mindestlohn wird zu weiterer Belastung für Gastrobranche
In vielen Restaurants machten laut Zöllick die Personalkosten inzwischen mehr als 40 Prozent der Ausgaben aus, der Wareneinsatz liege bei über 30 Prozent. Dazu kämen steigende Ausgaben für Energie, Versicherungen und Gebühren.
Seit Anfang 2022 seien, so Zöllick, die Arbeitskosten bis zum vierten Quartal 2024 um 34,4 Prozent gestiegen. Auch die Preise für Lebensmittel hätten kräftig angezogen – um 27,1 Prozent. Alkoholfreie Getränke verteuerten sich sogar um 33,7 Prozent, alkoholische um 17,9 Prozent. Die Energiekosten legten im selben Zeitraum um 27,6 Prozent zu (jeweils Juli 2025).
Zusätzlich steht zum 1. Januar 2026 eine weitere Belastung an: Der Mindestlohn steigt dann um 8,4 Prozent. Zöllick versicherte: „Soweit Spielräume vorhanden sind, werden unsere Gastronominnen und Gastronomen diese für attraktive Angebote und Investitionen in ihre Betriebe nutzen.“

























vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion