
Debatte um Solaranlagen-Förderung: Wie wichtig ist die Einspeisevergütung?

Mit der Überlegung, die staatliche Förderung von privaten Photovoltaik-Anlagen einzustampfen, hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine Debatte losgetreten. Ein Überblick über die Kosten und staatliche Förderung von Dachsolaranlagen:
Wie fördert der Staat PV-Anlagen?
Eine direkte Förderung des Bundes für die private Anschaffung einer PV-Anlage gibt es nicht.
Viele Städte, Gemeinden und Landkreise bieten Förderprogramme, die im Umfang teils sehr unterschiedlich ausfallen. Außerdem gibt es ein Programm der Förderbank KfW für Kredite für Solaranlagen.
Der Bund fördert die Installation von kleineren PV-Anlagen jedoch, indem er eine feste Vergütung für die Einspeisung von Strom ins Netz garantiert. Diese Einspeisevergütung hat Ministerin Reiche infrage gestellt.
[etd-related posts=“5213719″]
Wie funktioniert die Einspeisevergütung?
Die Einspeisevergütung hängt vor allem vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der PV-Anlage ab und bleibt dann 20 Jahre lang gleich. Als das zugrunde liegende Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) eingeführt wurde, war die Einspeisevergütung bedeutend höher:
2004 gab es noch garantiert 57,4 Cent pro Kilowattstunde – für 20 Jahre. Bis Ende 2023 sank die garantierte Vergütung für neue Anlagen auf gut acht Cent, seitdem sinkt sie alle sechs Monate um ein Prozent.
Aktuell, also für Anlagen, die ab dem 1. August in Betrieb genommen wurden, garantiert der Staat 7,86 Cent pro Kilowattstunde.
Wie wichtig ist die Einspeisevergütung für die Rendite?
Die Rendite einer PV-Anlage hängt von vielen Faktoren ab, etwa dem Installationspreis, der Größe und Ausrichtung des Daches und des eigenen Verbrauchs.
Grundsätzlich lohnt sich eine PV-Anlage umso mehr, je größer der eigene Stromverbrauch ist beziehungsweise je mehr des eigenen Verbrauchs mit dem selbst produzierten Strom gedeckt werden kann – denn der ist bedeutend günstiger als vom Stromanbieter.
[etd-related posts=“5195193″]
Das bedeutet auch: Eine PV-Anlage lohnt sich nicht in erster Linie wegen der Einspeisevergütung. Gekaufter Strom kostet häufig über 30 Cent pro Kilowattstunde. Die Ersparnis ist also deutlich höher als der Ertrag aus dem Stromverkauf.
Für wen lohnt sich eine PV-Anlage?
Besonders eignet sich eine Dachanlage zum Beispiel in Kombination mit einer Wärmepumpe oder auch einer Klimaanlage. Ladestrom für ein E-Auto mit der PV-Anlage zu produzieren ist ebenfalls fast immer sinnvoll.
Ausschlaggebend dafür, ob sich eine PV-Anlage lohnt oder nicht, ist allerdings oft bereits der Installationspreis – und der kann erheblich variieren. Es ist daher ratsam, Angebote von mehreren Installationsfirmen einzuholen.
Lohnt sich ein PV-Speicher?
Ein Stromspeicher ist häufig eine sinnvolle Ergänzung zur PV-Anlage, denn er hilft dabei, möglichst viel des produzierten Solarstroms selbst zu verbrauchen. Intelligent kombinierte Systeme mit Speicher und vielleicht noch Wärmepumpe und E-Auto machen auch die Einspeisevergütung weitgehend irrelevant.
Allerdings kostet ein Speicher schnell mehrere tausend Euro. Wichtig bei der Auswahl ist die richtige Größe. Denn je mehr Energie das Gerät speichern kann, desto teurer ist es, und zugleich bedeutet mehr Speicherkapazität nicht unbedingt mehr Ersparnis.
Am effizientesten ist es, wenn der Speicher über den Tag weitgehend aufgeladen, der gespeicherte Strom dann in den folgenden Stunden aber auch verbraucht wird. Denn der Stromspeicher entlädt sich mit der Zeit selbst, der Strom geht also verloren.
Wenn zum Beispiel in der Nacht die Wärmepumpe läuft oder das E-Auto lädt, bringt der Speicher mehr als in Haushalten, in denen nachts kaum Strom verbraucht wird.
Smart Meter und Steuerbox
Dass es immer mehr Photovoltaik-Anlagen gibt, führt dazu, dass zu manchen Zeiten zu viel Strom produziert wird. Im schlechtesten Fall gefährdet das die Netzstabilität.
Seit Februar gilt deshalb das sogenannte Solarspitzengesetz. Es schreibt vor, dass neue Anlagen mit einem Smartmeter, also einem intelligenten Stromzähler, und einer sogenannten Steuerbox ausgerüstet werden müssen. Dies gibt dem Netzbetreiber Zugriff auf die Anlage und er kann sie im Fall von Produktionsspitzen abschalten.
Einbau und Betrieb der Gerätschaften schlagen je nach Anlage mit bis 160 Euro pro Jahr zu Buche. Zudem erhalten Anlagenbetreiber dann während der Spitzenzeiten, wenn wegen des großen Angebots der Strompreis an der Börse negativ ist, keine Einspeisevergütung.
In der Realität sind die finanziellen Einbußen dadurch in den meisten Fällen aber überschaubar, besonders wenn die Anlage mit einem Speicher betrieben wird.
Balkonkraftwerke
Wer nicht die Möglichkeit hat, eine Dachsolaranlage zu installieren, kann eventuell mit einer kleineren Balkonanlage dennoch eigenen Solarstrom produzieren.
Die Vorgaben dafür wurden im vergangenen Jahr gelockert. Etwa müssen Balkonkraftwerke nicht mehr beim Netzbetreiber registriert werden, ein Eintrag ins Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur reicht aus.
Auch haben Mieter sowie Besitzende von Eigentumswohnungen nun grundsätzlich Anspruch auf Strom vom Balkon. Das bedeutet, dass der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft nur noch in Ausnahmefällen die Installation eines Balkonkraftwerks verhindern kann. (afp/red)




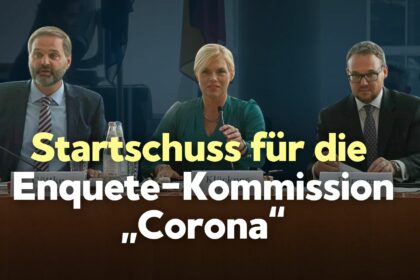

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion