
Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik: Bundesregierung stoppt humanitäre Aufnahmeprogramme

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat verkündet, dass alle humanitären Aufnahmeverfahren in Deutschland derzeit ausgesetzt sind. Seit Freitag, 25. Juli, findet sich auch auf der offiziellen Seite seiner Behörde zu den Programmen nach Paragraf 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz ein gut sichtbarer Hinweis.
Programme dieser Art hatten der Bund und auch die Bundesländer mit Ausnahme von Bayern eingerichtet. Sie sollten bestimmten Gruppen von Schutzsuchenden einen leichteren und sicheren Zugangsweg nach Deutschland ermöglichen. Eine Fortführung der Länderprogramme ist, wie das Bundesministerium mitteilt, nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung des Bundes zulässig. Die 2019 von mehreren Kommunen initiierte Aktion „Sichere Häfen“ hatte von vornherein nur Appellcharakter. Bis zu 250 Städte und Landkreise hatten damals erklärt, bereit zu sein, mehr Geflüchtete aufzunehmen, als ihnen gesetzlich zugedacht waren.
Auf Landesebene Aufnahmeprogramme nur noch mit Bundeszustimmung
Die einschlägige Bestimmung des Paragrafen 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz setzt die „Wahrung besonders gelagerter politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland“ voraus. Das Innenministerium des Bundes kann sich mit den Landesbehörden ins Einvernehmen setzen. Anschließend kann es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dazu anhalten, Schutzsuchenden aus bestimmten Staaten oder Ausländergruppen eine Aufnahmezusage zu erteilen.
[etd-related posts=“5197540″]
In der Folge findet kein reguläres Asylverfahren statt und die Begünstigten erhalten eine Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis. Dabei kann die Niederlassungserlaubnis mit einer Auflage versehen werden, die den Wohnsitz beschränkt. Eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 23 berechtigt grundsätzlich nicht zur Erwerbstätigkeit, es sei denn, die Anordnung sieht Abweichendes vor.
Bis dato hatte es mehrere humanitäre Aufnahmeprogramme in Deutschland gegeben. Auf Bundesebene nahm Deutschland seit 2012 jährlich mehrere tausend als besonders gefährdet geltende Geflüchtete im Rahmen des Resettlement-Programms des UNHCR auf. Seit 2022 besteht auch ein Programm für Personen aus besonders gefährdeten Gruppen in Afghanistan.
Bei Familienangehörigen waren private Kostenverpflichtungen erforderlich
Für syrische und staatenlose Schutzsuchende aus der Türkei gibt es auf Bundesebene seit 2017 ebenfalls ein Aufnahmeprogramm. Auf Ebene der Bundesländer hatte es ebenfalls Programme gegeben. Diese betrafen unter anderem Angehörige bereits im Land befindlicher Geflüchteter aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. Hier waren häufig private Verpflichtungen zur Kostenübernahme erforderlich.
Auf zivilgesellschaftlicher Ebene gab es ebenfalls Möglichkeiten, mit Zustimmung der zuständigen Behörden besonders schutzbedürftigen Personen eine Aufnahme zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist das 2019 aufgelegte Pilotprogramm „Neustart im Team“ (NesT). Dabei übernahmen Mentoring-Gruppen die entsprechende Betreuung Geflüchteter im Rahmen des Integrationsprozesses.
[etd-related posts=“5193694″]
Seit 2015 hatte Deutschland insgesamt etwa 12.000 Personen über das Resettlement-Programm des UN-Flüchtlingshilfswerks aufgenommen. Mehr als die Hälfte davon – rund 6.900 – waren syrische Staatsangehörige. Dazu kamen unter anderem auch 1.200 Sudanesen, 1.000 Somalier, 770 Menschen aus Eritrea und 690 aus dem Südsudan.
In 13 Jahren halfen die Aufnahmeprogramme mehr als 50.000 Menschen
Bereits vor 2015 hatten Bund und Länder auch in den Jahren 2013 und 2014 jeweils 10.000 Syrer im Rahmen von Aufnahmeprogrammen nach Deutschland geholt. Einer Antwort der Bundesregierung auf eine damalige Anfrage der FDP-Fraktion zufolge hatte es zwischen 2003 und 2019 insgesamt 32.542 Aufnahmen von Geflüchteten im Rahmen von Resettlement-Programmen gegeben.
Im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan hat Deutschland seit der erneuten Machtübernahme der Taliban etwa 34.700 als besonders gefährdet geltende Personen aufgenommen. Die meisten davon profitierten vom Sonderprogramm für Ortskräfte. So gab es bis zum Stopp des Programms im März 2025 Aufnahmezusagen für 24.777 Menschen. Von diesen reisten bislang 20.806 Teilnahmeberechtigte ein.
[etd-related posts=“5182627″]
Insgesamt summiert sich die Zahl der Menschen, die zwischen 2012 und 2025 von humanitären Aufnahmeverfahren in Deutschland profitierten, auf mehr als 50.000. Dazu kommen die regulären Flüchtlinge und die Geflüchteten aus der Ukraine, die über einen Sonderstatus nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz verfügen.
Grüne empört: Auch Regierungsgegner aus Russland betroffen
Neben den größer angelegten Programmen gab es auch humanitäre Aufnahmeprogramme für bestimmte als gefährdet definierte Personengruppen. Dazu gehörten beispielsweise als Regierungsgegner eingestufte Schutzsuchende aus der Russischen Föderation. Diese befürchten nun eine Verschlechterung ihrer Situation, da sie damit einen wichtigen legalen Fluchtweg nach Deutschland und Europa verlieren.
Seit der Ankündigung des Endes der freiwilligen Aufnahmeprogramme durch die Bundesregierung werden kaum noch Aufnahmezusagen erteilt, bestehende Verfahren sind ausgesetzt. Vor allem in den Reihen der Grünen hat dies massive Kritik ausgelöst. Die Rede war von einer „Drecksarbeit für Putin“ aufseiten der Bundespolitik.



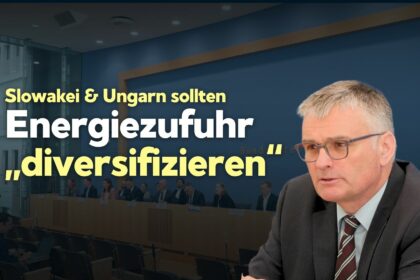
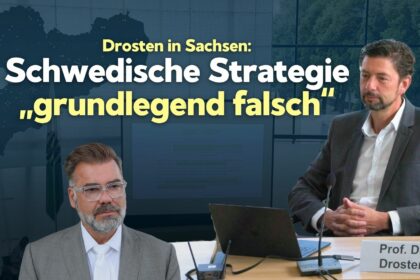

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion