
Neues Wehrdienstgesetz – alles freiwillig, oder was?

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, 27. August, das neue Wehrdienstmodell verabschiedet. Es geht um eine einfache gesetzliche Änderung, also ohne Änderung des Grundgesetzes.
Das Verteidigungsministerium (BMVg) rechnet mit 15.000 Bewerbern noch in diesem Jahr und bis zu 20.000 im kommenden Jahr. Insgesamt benötigt die Bundeswehr nach Einschätzung der Generalität etwa 80.000 zusätzliche aktive Soldaten, um die Zielvorgabe der NATO von 260.000 zu erreichen. Das Gesetz soll Anfang 2026 in Kraft treten.
[etd-related posts=“5171182″]
Zum 18. Geburtstag kommt ein Brief
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist nach wie vor davon überzeugt, dass die angestrebte Personalerhöhung bei der Bundeswehr auf freiwilliger Basis funktionieren werde. Dennoch soll ab 2027 eine verpflichtende Musterung für alle Männer ab 18 Jahren eingeführt werden. Frauen können sich freiwillig melden.
Wie das BMVg mitteilt, sei das Ziel des neuen Wehrdienstes, „die Zahl der zur Verfügung stehenden Reservistinnen und Reservisten zu erhöhen“. Er soll zwischen mindestens sechs und 23 Monate dauern. Wie lange ein freiwillig Wehrdienstleistender nach sechs Monaten Grundwehrdienst noch bei der Bundeswehr bleiben möchte, „kann jeder und jede für sich selbst entscheiden“, erklärt das BMVg.
[etd-related posts=“4950831″]
Die Bundeswehr erhofft sich durch diese Maßnahme, künftig sowohl mehr Berufssoldaten als auch Reservisten zu gewinnen.
Um dem Fall vorzubeugen, dass sich pro Jahr nicht genügend Freiwillige melden, soll im Gesetz die Wehrerfassung wieder verankert werden. Sie soll laut BMVg „an das aktuelle Melderecht angepasst werden“.
Das heißt: Die Bundeswehrverwaltung soll direkten Zugriff auf die Adressen der Meldebehörden erhalten, um auf diese Weise alle 18-jährigen Männer erreichen zu können. Dies sieht Paragraf 15 des neuen Wehrdienstgesetzes vor.
Dort heißt es: „Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf zum Zweck der Wehrerfassung die Daten Wehrpflichtiger nach den §§ 34, 34a, 38 und 39 des Bundesmeldegesetzes verarbeiten.“
Alle jungen Männer „erhalten nach ihrem 18. Geburtstag einen Brief mit einem QR-Code zugesandt, der zu einem Onlinefragebogen führt“, erklärt das BMVg. „Junge Männer sind verpflichtet, den Fragebogen auszufüllen. Für Frauen und Personen anderen Geschlechts ist die Beantwortung der Fragen freiwillig“, wird versichert.
[etd-related posts=“4871403″]
So will die Bundeswehr die Eignung prüfen
In dem Fragebogen sollen persönliche Daten, Motivation und Interesse am Wehrdienst, die Verfügbarkeit, Fitness sowie Bildungsabschlüsse abgefragt werden. Wer sich außerdem bereit erklärt, Wehrdienst zu leisten, kann bei der Bundeswehr vorstellig werden.
Bei einer Befragung vor Ort wollen die Militärs dann feststellen, ob sich die interessierte Person tatsächlich zum Dienst an der Waffe eignet. Erst dann erfolgt die militärische Musterung. Auf diese Weise will die Bundeswehr „ein besseres Lagebild über Eignung und Qualifikation der Wehrpflichtigen“ erhalten, heißt es im BMVg.
Und weiter: „Damit wird eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, bei einer Reaktivierung der Wehrpflicht im Spannungs- und Verteidigungsfall unmittelbar auf einen belastbaren Datenbestand und bestehende administrative Strukturen zurückgreifen zu können. Die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte soll dadurch deutlich verbessert werden.“
Da nach der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 erst wieder entsprechende Strukturen aufgebaut werden müssen, soll die verpflichtende Musterung erst ab dem 1. Juli 2027 eingeführt werden. Das BMVg rechnet mit 300.000 Wehrpflichtigen pro Jahr.
Bundeswehr braucht 460.000 Soldaten
In einem BMVg-Referentenentwurf vom 30. Juli, der als Grundlage für die Kabinettsberatung dient, heißt es: In einem Kriegsfall „ist insgesamt von einem notwendigen Verteidigungsumfang von 460.000 Soldatinnen und Soldaten einschließlich der Reserve auszugehen“.
Eine rasche Erhöhung der Zahl an Soldaten sei für die „Durchhaltefähigkeit“ von „grundlegender Bedeutung, um in Krise und Krieg langfristig bestehen und Deutschland und seine Verbündeten erfolgreich verteidigen zu können“, begründet der Referentenentwurf weiterhin das Gesetzesvorhaben. Und fügt hinzu: „Dies bereits im Frieden entschlossen umzusetzen, ist ein zentraler Baustein der Abschreckung mit dem Ziel, einen Krieg nicht führen zu müssen.“
Erreicht werden soll das Ziel „durch eine deutlich gesteigerte Attraktivität, Wertschätzung und einen sinnhaften, anspruchsvollen Dienst“. Dazu soll auch der „Anteil von Frauen und von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Bundeswehr“ erhöht werden, schlägt der Referentenentwurf vor.
[etd-related posts=“5213716″]
Kriegsdienstverweigerung möglich, aber …
Im Falle einer verpflichtenden Heranziehung soll auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung (KDV) geändert und wieder möglich sein, um das Grundrecht aus Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz wahrnehmen zu können. Deshalb sieht der neue Wehrgesetzentwurf vorsorglich entsprechende Anpassungen im Kriegsdienstverweigerungsgesetz und im Zivildienstgesetz vor.
Dort heißt es in Absatz 2: „Wehrpflichtige, die als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden sind, haben im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder nach Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach § 2a des Wehrpflichtgesetzes, statt des Wehrdienstes Zivildienst außerhalb der Bundeswehr als Ersatzdienst nach Artikel 12a Absatz 2 des Grundgesetzes zu leisten.“ Problem: Dann muss auch die Ableistung eines Ersatzdienstes organisiert und durchgesetzt werden.
Kostet viel Geld
Wie in dem Referentenentwurf weiterhin zu erfahren ist, werden für den Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums für das kommende Jahr 495 Millionen Euro an Ausgaben prognostiziert. Für die Jahre 2027 werden Mehrkosten von 603 Millionen Euro, für 2028 rund 713 Millionen Euro und für 2029 rund 849 Millionen Euro erwartet.
Die Mehrausgaben dienen auch dazu, den Dienst bei der Bundeswehr attraktiver zu gestalten. „Die Freiwilligkeit erreichen wir vor allem durch die Attraktivität des Diensts“, argumentiert Verteidigungsminister Pistorius.
So wird im neuen Wehrdienstgesetz in Paragraf 31b zum Beispiel ein Zuschuss für den zivilen Erwerb eines Führerscheins der Klasse B für mehr als zwölf Monate Dienende angeboten. Reservisten erhalten höhere Prämien (Paragraf 17a). Für alle gibt es freie Bahntickets. Auch freie schulische Fortbildung für diejenigen, die länger dienen, gehört dazu.
Alle Wehrdienstleistenden, die sich für mehr als sechs Monate verpflichten, sollen künftig in die Kategorie „Zeitsoldat“ fallen und erhalten statt 1.840 Euro brutto monatlich rund 2.700 Euro brutto. Unterkunft, Verpflegung und ärztliche Versorgung sind während des Wehrdienstes frei.
Und: Wer sich für mindestens zwölf Monate verpflichtet, bekommt bis zu 3.500 Euro Zuschuss für den Führerschein (Klasse B).
Wenn Freiwilligkeit nicht ausreicht
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich „zuversichtlich, dass wir zunächst jedenfalls die Zahlen, die wir brauchen, erreichen“.
Schon jetzt stiegen die Zahlen der Bewerber, erklärte Pistorius. Der Verteidigungsminister betonte zugleich, dass nicht garantiert sei, dass die Freiwilligkeit ausreicht. „Wenn das nicht funktioniert, werden wir nachsteuern müssen.“ Über einen verpflichtenden Wehrdienst müsse jedoch dann erneut Kabinett und Parlament entscheiden.

Kanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius am 27.08.2025. Foto: via dts Nachrichtenagentur






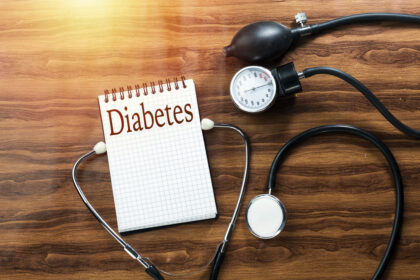



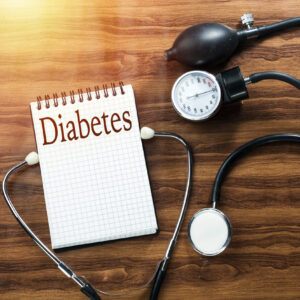














vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion