
Sozialbeiträge steigen: Wer ab 2026 mehr zahlen muss

In Kürze:
- Das Bundeskabinett beschließt höhere Beitragsbemessungsgrenzen ab 2026.
- Rentenversicherung künftig bis 8.450 Euro Bruttoeinkommen beitragspflichtig
- Kranken- und Pflegeversicherung: Die Grenze steigt auf rund 5.800 Euro.
- Arbeitnehmer mit 9.000 Euro brutto zahlen künftig über 1.050 Euro mehr im Jahr.
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung beschlossen. Damit werden ab 1. Januar 2026 die Sozialbeiträge für Besserverdienende weiter steigen. Bereits im Vorjahr hatte es eine deutliche Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherung gegeben. Die damalige Ampelregierung hatte diese mit dem deutlichen Plus bei den Bruttolöhnen begründet.
Beitragsbemessungsgrenze steigt in nur zwei Jahren um bis zu 1.000 Euro
In der gesetzlichen Rentenversicherung soll die Beitragsbemessungsgrenze von bislang 8.050 auf 8.450 Euro an Bruttoeinkommen steigen. Im Jahr 2024 hatte diese noch bei 7.550 Euro (West) und 7.450 Euro (Ost) gelegen. In der Kranken- und Pflegeversicherung steigt die Grenze jeweils von 5.512,50 auf etwa 5.800 Euro. Vor zwei Jahren hatte sie bei 5.175 Euro gelegen.
[etd-related posts=“5237523″]
Bis zur Beitragsbemessungsgrenze werden von gesetzlich Pflichtversicherten Beiträge zur Sozialversicherung erhoben. Einkommensteile, die oberhalb dieser Grenze liegen, werden nicht mehr zur Berechnung herangezogen. Für Betroffene führt dies zu einer deutlichen Erhöhung der Sozialbeiträge.
Wer derzeit ein Bruttoeinkommen von 9.000 Euro bezieht und ein Kind hat, hätte angesichts der um 400 Euro höheren Beitragsbemessungsgrenze bei 9,3 Prozent Arbeitnehmeranteil in der Rentenversicherung monatlich 37,20 Euro mehr zu bezahlen. Statt derzeit 748,65 Euro wären es künftig 785,85 Euro. Im Jahr würde das 446,40 Euro Mehrbelastung entsprechen.
Zusatzkosten im vierstelligen Bereich
In der Arbeitslosenversicherung, in der der Arbeitnehmeranteil 1,3 Prozent beträgt, würde sich der Höchstbeitrag von 104,65 auf 109,85 Euro erhöhen – ein Plus von monatlich 5,20 Euro. In der Krankenversicherung beträgt der reguläre Beitragssatz 14,6 Prozent. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse. Im Vorjahr lag dieser im Schnitt bei etwa 2,5 Prozent.
Der Arbeitnehmer mit dem Bruttoeinkommen von 9.000 Euro würde statt derzeit 471,32 künftig 511,50 Euro im Monat und damit 40,18 Euro mehr entrichten. In der Pflegeversicherung liegt der Anteil des Arbeitnehmers mit einem Kind bei etwa 1,8 Prozent. Statt 99,22 würde er künftig 104,62 Euro bezahlen und damit um 5,40 Euro im Monat mehr.
[etd-related posts=“5238532″]
Im Jahr 2025 liegt der monatliche Höchstbeitrag zu allen Bereichen der Sozialversicherung bei insgesamt 1.423,84 Euro. Künftig steigt dieser um 87,98 Euro im Monat auf 1.511,82 Euro. Die jährliche Mehrbelastung würde sich damit um 1.055,76 Euro erhöhen. Da Arbeitgeber dieselben Anteile zu tragen haben, steigen auch deren Kosten in gleichem Maße.
Höhere Beitragsbemessungsgrenze soll „Besserverdiener stärker an Finanzierung der Sozialsysteme beteiligen“
Ausschlaggebend für die Anhebung ist die Lohn- und Gehaltsentwicklung des Jahres 2024. Die durchschnittliche Lohnzuwachsrate lag in jenem Jahr bei etwa 5 Prozent. Der Bundesrat muss der Neuregelung noch zustimmen. Die Ministerien hatten der Anpassung bereits im Vorfeld im Wege der sogenannten Ressortabstimmung zugestimmt.
Aus dem Ministerium hieß es, dass die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze ausschließlich Spitzenverdiener betrifft. Auf die Sozialbeiträge der meisten Beschäftigten habe die Anpassung keine Auswirkung. Die zusätzlichen Mittel sollen helfen, Finanzierungslücken in den Sozialversicherungssystemen entgegenzuwirken. Der Bund will Gutverdienende stärker an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme beteiligen.
[etd-related posts=“5238470″]
Von der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung sollen etwa 2,1 Millionen Beschäftigte oder 9,6 Prozent der unselbstständig Vollzeiterwerbstätigen betroffen sein. In der Krankenversicherung, in der ein Wechsel in die private Krankenversicherung erst ab 6.450 Euro brutto möglich sein wird, werden sogar 5,5 Millionen gesetzlich Versicherte mit Mehrbelastungen rechnen müssen.
„Fatal für den Wirtschaftsstandort“: Connemann sieht Gefahr für Standort
Neben Arbeitnehmern sind auch zahlreiche Selbstständige oder freiwillig Versicherte von den Änderungen betroffen. Den Ausschlag diesbezüglich gibt das jeweilige Einkommen. Befürworter verteidigen die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen als notwendig zur nachhaltigen Sicherung der Sozialleistungen.
Kritiker bemängeln, dass die Reform zu einer Belastung der wichtigsten Leistungsträger führen könne. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Gitta Connemann (CDU), nannte den Entwurf im Vorfeld „fatal für den Wirtschaftsstandort“. Die Erhöhung würde infolge steigender Lohnzusatzkosten besonders den Mittelstand „ins Mark treffen“.







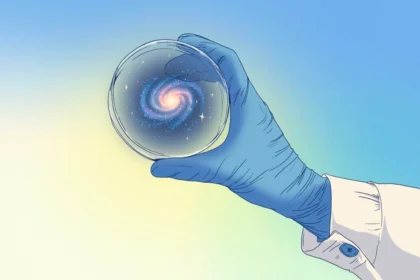
















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion