
Spannungsfall: Was im Ernstfall auf Bürger zukommt

„Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Wir müssen viel mehr für unsere eigene Sicherheit tun“, mahnte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am 29. September in einem Redaktionsgespräch mit der „Rheinischen Post“. Der Kanzler betonte weiter: „Wir sehen die Luftraum-Verletzungen seit Wochen, es wird immer schlimmer.“
Soll die Bundeswehr Polizeibefugnisse bekommen?
Genau wegen der sich häufenden Drohnenvorfälle über Staaten an der sogenannten NATO-Ostflanke sowie inzwischen auch über deutschen Flughäfen und Bundeswehrkasernen ist Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bereit, „die Befugnisse der Bundeswehr“ im Inneren auszuweiten. „Ich will im Luftsicherheitsgesetz festschreiben, dass die Bundeswehr der Polizei im Inneren Amtshilfe leisten darf – gerade bei Drohnenabwehr-Einsätzen“, sagte Dobrindt laut der „Rheinischen Post“.
Der Bundesinnenminister will die Polizeikräfte von Bund und Ländern sowie die Bundeswehr „vernetzen“ und dafür ein Drohnen-Kompetenzzentrum aufbauen. Diese Idee ist nicht neu. Im Juni übten bereits rund hundert Spezialkräfte von Bundeswehr, Polizei, Bundeskriminalamt und der NATO in Münster. Dies teilte das Verteidigungsministerium auf seiner Website mit. Die Übung trug den Titel „Summer Jamm 2025“. Ziel sei es gewesen, „die gemeinsame Fähigkeit zur Drohnenabwehr“ und die „zivil-militärische Zusammenarbeit zu verbessern“.
[etd-related posts=“5213200″]
CDU-Politiker Kiesewetter will Spannungsfall ausrufen
Dennoch gehen Dobrindts Pläne manchen Politikern nicht schnell und nicht weit genug. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter stieß in den vergangenen Tagen eine vollkommen neue Debatte an: die Ausrufung des sogenannten Spannungsfalls. Solch eine Überlegung sei notwendig, sagte er dem Düsseldorfer „Handelsblatt“ am 29. September, damit Drohnen von der Bundeswehr „sofort abgewehrt werden können“. Bislang ist der Bundeswehr Drohnenbekämpfung lediglich über ihren Kasernen, Truppenübungsplätzen und weiteren militärischen Liegenschaften erlaubt.
Kiesewetter, der auch Oberst der Reserve ist, macht sich dafür stark, dass die Bundeswehr ab sofort grundsätzlich für die Luftsicherung von kritischen Infrastrukturen (KRITIS) herangezogen werden darf. Damit sind zum Beispiel die Strom- und Wasserversorgungsbereiche gemeint, aber auch Gebäude und Anlagen mit Informationstechnik, Telekommunikation und Transport- und Verkehrswege.
Der Verfassungsschutz definiert KRITIS folgendermaßen: „Damit sind Anlagen, Systeme und Organisationen gemeint, die eine wichtige Bedeutung für die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Funktionen haben. Deren Ausfall hätte erhebliche Auswirkungen auf das Gemeinwesen, zum Beispiel in Form von Versorgungsengpässen und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.“
Kiesewetter begründete laut Zeitung seinen Vorstoß damit, dass sich hybride Angriffe nicht eindeutig nach äußerer und innerer Sicherheit trennen ließen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) widerspricht hingegen seinem Parteikollegen. Laut der „Deutschen Presse-Agentur“ habe Merz auf den Vorstoß von Roderich geantwortet: „Ich sehe das nicht so.“
Debatte losgetreten
Die Partei Die Linke im Bundestag sprang indes auf die Debatte auf. Der Abgeordnete Ulrich Thoden aus Münster postete für seine Partei auf der Plattform X: „Die Ausrufung des Spannungsfalls, der die letzte Vorstufe zum Verteidigungs- und damit womöglich auch zum Kriegsfall ist, kann eine gefährliche Eskalationslogik in Gang setzen und trägt zu einer weiteren Militarisierung der Gesellschaft bei. Die damit verbundene Einschränkung von Grundrechten, die Reaktivierung der Wehrpflicht oder die Mobilisierung von Reservisten werden dem Problem von Drohnenüberflügen nicht gerecht und sind abzulehnen.“
Der einstige deutsche Diplomat und BSW-Europapolitiker Michael Graf von der Schulenburg warf am 2. Oktober in einem Beitrag der Frauenzeitschrift „Emma“ unter der Überschrift „Deutschland auf dem Kriegspfad“ die Frage auf: „Warum haben deutsche Politiker so wenig aus der Geschichte gelernt?“ Er kritisiert, dass das Jahr 2029 „als angepeilter Kriegsbeginn ausgerufen“ werde. Das wars dann schon an Reaktionen auf Kiesewetters Testballon zur Ausrufung des Spannungsfalls.
[etd-related posts=“5262432″]
Notstandsgesetze und Spannungsfall
Für den Umgang mit staatlichen Krisensituationen hat die Politik schon seit Längerem vorgesorgt. Am 30. Mai 1968 verabschiedete der Bundestag die sogenannten Notstandsgesetze. Damals wurde nach einer vierstündigen Debatte mit dem 17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes die Einführung einer Notstandsverfassung gebilligt. Mit dieser Entscheidung wurde ein zehn Jahre langer Streit unter den Parteien beendet, wie die Bundesregierung in einer Krisensituation handlungsfähig bleiben könne.
Kernpunkt der Notstandsgesetze: Die Bundeswehr darf zur „Bekämpfung militärisch bewaffneter Aufständischer“ – also auch gegen die eigene Bevölkerung – eingesetzt werden. Darüber hinaus können die Grundrechte jedes Bürgers eingeschränkt werden. Die Notstandsgesetze sind seit dem 28. Juni 1968 in Kraft.
Auch der Begriff „Spannungsfall“ wurde in den Sechzigerjahren im Grundgesetz verankert. Bis zum Vorstoß Kiesewetters war der Begriff jedoch weitgehend vergessen. Gemeint ist jene Grauzone zwischen Frieden und Krieg, auf die Merz vor wenigen Tagen Bezug genommen hatte. Denn auch wenn kein Kriegsfall eingetreten ist, kann sich der Staat mittels Ausrufung eines Spannungsfalls selbst besondere Befugnisse geben, die er im Normalfall nicht hat. In anderen Staaten wird die gleiche Situation meist „Ausnahmezustand“ genannt.
Wehrpflicht wäre sofort in Kraft
Der Spannungsfall ist in Artikel 80a des Grundgesetzes nur vage angesprochen. Dort ist lediglich geregelt, was erforderlich ist, um ihn auszurufen. Zum Beispiel braucht die Regierung dazu eine „Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen“ der Abgeordneten. Erst dann können auch hier die Notstandsgesetze in Kraft treten. Anders als bei der Feststellung eines Kriegsfalls ist der Bundesrat an der Entscheidung nicht beteiligt.
Die Bundeswehr dürfte dann beispielsweise Sperrzonen einrichten, die kein Zivilist mehr betreten darf, etwa in grenznahen Bereichen. Auch zivile Lkw und ihre Fahrer dürften für Logistikaufgaben des Militärs zwangsverpflichtet werden. Reisen könnten untersagt werden, um die Bahn für Polizeikräfte und Soldaten offen zu halten. Auch Sanitäts- und Rettungspersonal könnte für bestimmte Regionen aus anderen Teilen Deutschlands abgezogen werden.
Am wichtigsten: Mit Feststellung des Spannungsfalls ist die Wehrpflicht automatisch umgehend wieder in Kraft. Das regelt das Wehrpflichtgesetz (WPflG) seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011. Dort heißt es etwa in § 48 WPflG Absatz 1 Nummer 5, dass „männliche Personen, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, auf Anordnung der Bundesregierung Vorsorge dafür zu treffen“ haben, „dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörde sie unverzüglich erreichen, auch wenn sie der Wehrüberwachung nicht unterliegen“.
Wer aus dieser Gruppe Deutschland verlassen möchte, muss zuvor „die Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr“ erhalten. Und schließlich: Wer sich im wehrfähigen Alter im Ausland aufhält, hat „unverzüglich zurückzukehren“ und „sich beim zuständigen oder nächsten Karrierecenter der Bundeswehr“ zu melden.







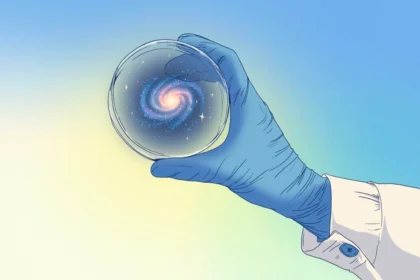
















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion