
SPD realistisch, aber ohne Wachstumsimpulse – Union, FDP und AfD würden Defizit ausweiten

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat zwei Wochen vor der Bundestagswahl die Steuerpläne mehrerer Parteien unter die Lupe genommen. Dabei lag der Schwerpunkt auf den zu erwartenden Auswirkungen auf den Staatshaushalt. Den Forschern zufolge würden dabei vor allem die Vorhaben von CDU/CSU, FDP und AfD das Haushaltsdefizit in erheblichem Maße erhöhen. Die geringste Belastung für den Haushalt wäre mit dem Programm der SPD verbunden – allerdings wäre auch der Entlastungseffekt für die Steuerpflichtigen geringer.
DIW erwartet dreistelligen Milliarden-Fehlbetrag durch Unionsvorhaben
Der Untersuchung, über die das „Handelsblatt“ berichtet, zufolge wären beispielsweise im Fall der Umsetzung des Steuerprogramms von CDU und CSU Mindereinnahmen von mehr als 111 Milliarden Euro zu erwarten. Die Union will unter anderem „schrittweise“ die Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland von derzeit fast 30 auf 25 Prozent auf einbehaltene Gewinne reduzieren.
Außerdem wollen CDU und CSU den Steuerfreibetrag erhöhen und den Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro greifen lassen. Der Solidaritätszuschlag soll nach dem Modell der Union komplett wegfallen. Derzeit liegt die Grenze bei 68.430 Euro. Die Union hat eingeräumt, dass ein Gegenfinanzierungsmodell bislang fehlt.
DIW-Ökonom Stefan Bach, der mit der Analyse betraut worden war, räumt ein, dass von dem Konzept von CDU und CSU auch Wachstumseffekte zu erwarten wären. Allerdings würden diese sich lediglich auf etwa 30 Milliarden Euro belaufen – und damit nur knapp ein Viertel der Mindereinnahmen. Das Staatsdefizit wüchse um 2,5 Prozent an.
FDP und AfD würden höchsten Einnahmenengpass für den Bundeshaushalt bewirken
Noch höher wäre der zusätzliche Fehlbestand im Bundeshaushalt unter den Bedingungen der Steuerpläne von FDP und AfD. Die Liberalen stellen eine Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Einkommenssteuer um 1.000 Euro an, der Spitzensteuersatz soll erst ab 96.600 Euro greifen. Bezüglich der Unternehmenssteuerbelastung und des Solidaritätszuschlages ist die FDP auf Unionslinie – und will sogar auf eine Unternehmensbesteuerung unter 25 Prozent gelangen. Die Liberalen wollen auch eine „Klimadividende“ von 136 Euro je Einwohner ausschütten.
Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm ein Ende der CO₂-Abgabe und eine deutliche Reduktion der Energiesteuern. Der Solidaritätszuschlag soll wegfallen, der Steuerfreibetrag auf 14.000 Euro und der Sparerpauschbetrag auf 2.400 Euro steigen. Ein Aus sieht die Partei auch für die Grunderwerbsteuer auf Wohneigentum sowie die Erbschaftsteuer vor. Außerdem tritt die AfD für ein Familiensplitting und eine Willkommensprämie für Neugeborene in Höhe von 20.000 Euro ein.
Die Wachstumseffekte der FDP-Vorschläge beziffert das DIW auf etwa 49 Milliarden Euro, bei der AfD wären es 32,1 Milliarden. Demgegenüber würde das Defizit des Bundes durch die Pläne der FDP um 188 Milliarden Euro steigen, eine ähnliche Größenordnung würden die AfD-Vorhaben verursachen.
Das DIW bemängelt auch soziale Unausgewogenheit bei Union, FDP und AfD
DIW-Ökonom Bach hält die Vorschläge der Parteien angesichts der Haushaltlage für „utopisch“. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Fehlbetrag für den Haushalt 2025 im Rahmen des TV-Duells mit Herausforderer Friedrich Merz erneut auf etwa 25 Milliarden Euro beziffert. Mit dem Auslaufen des Bundeswehr-Sondervermögens müssten ab 2028 zusätzliche 30 Milliarden Euro jährlich aus dem Bundeshaushalt gestemmt werden – um das NATO-Ziel zu erfüllen.
Die Wirtschaftsforscher halten die Steuerpläne auch für unausgewogen. Das Unionskonzept würde bewirken, dass die Hälfte der Steuersenkungen bei den einkommensstärksten zehn Prozent der Bevölkerung ankäme. Nur elf Prozent kämen der unteren Hälfte an, die Bruttolohnentlastungen unterer Einkommen lägen nur bei 1,5 Prozent. Die FDP-Vorhaben würden das reichste Prozent der Bevölkerung um durchschnittlich zehn Prozent oder knapp 50.000 Euro pro Jahr entlasten.
Im Fall der Union wären es sieben Prozent oder 34.000 Euro. Die AfD würde das oberste Prozent der Spitzenverdiener um etwa 41.000 Euro pro Jahr entlasten. Allerdings wären in ihrem Fall auch die untersten Einkommen stärker begünstigt als bei Union und Liberalen. Wie das DIW einräumt, tragen die zehn Prozent Top-Verdiener derzeit auch fast 60 Prozent der gesamten Einkommensteuerlast.
SPD will Reiche belasten – Grüne legen auch Hand an das Ehegattensplitting
Die Pläne von SPD und Grünen führten demgegenüber zu geringeren Haushaltslücken. Beide wollten untere und mittlere Einkommen entlasten, gleichzeitig jedoch wohlhabendere Bevölkerungsgruppen stärker belasten. Die Sozialdemokraten wollen den Spitzensteuersatz jedoch auf 45 Prozent erhöhen. Die sogenannte Reichensteuer, die ab 277.825 Euro fällig wird, soll künftig 47 Prozent betragen.
Ebenso wollen die Sozialdemokraten Veränderungen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die ebenfalls Spitzenverdiener treffen sollen. Allerdings fordert die SPD auch eine – nach Möglichkeit „im Einklang mit den europäischen Partnern“ umgesetzte – Finanztransaktionssteuer. Diese träfe jedoch nicht allein Milliardäre und professionelle Börsenspekulationen, sondern auch Riestersparpläne oder Pensionsfonds.
Auch die Grünen wollen „große Erbschaften“ durch eine höhere Erbschaftssteuer belasten. Sie wollen außerdem eine „Milliardärssteuer“ einführen. Das Ehegattensplitting soll es nicht mehr geben. Kleinere Einkommen sollen immerhin von noch höheren Belastungen verschont bleiben. Dafür soll die Stromsteuer „auf das europäische Minimum“ sinken.
Berechnungen beruhen teils auf eigenen Annahmen – auch zusätzliche Sozialausgaben nicht berücksichtigt
Die Grünen-Pläne würden aufgrund des höheren steuerlichen Grundfreibetrages in der Einkommenssteuer und die Investitionsprämie für Unternehmen Steuerausfälle von 36 Milliarden Euro bewirken. Allerdings würden diesen laut DIW etwa 20 Milliarden an Wachstumseffekten gegenüberstehen.
Nur 11,4 Milliarden Euro an zusätzlichen Haushaltslücken wären vom Konzept der SPD zu erwarten, so Bach. Demgegenüber wären auch deren Wachstumseffekte mit 3,1 Milliarden Euro deutlich geringer. Die größeren Entlastungen bei der Investitionsprämie oder Einkommenssteuer hätten dem DIW zufolge relativ hohe wirtschaftliche Effekte haben. Demgegenüber würden die Belastungen zumindest bei der Immobilienbesteuerung keine großen wirtschaftlichen Nachteile auslösen.
Für die Analyse zog Bach die Steuerprogramme der Parteien heran und holte weitere Informationen durch Nachfrage ein. Wo die Parteien keine konkreten Annahmen zu Steuerplänen und Tarifen übermittelten, habe er mit eigenen Annahmen operiert. Auf dieser Datenbasis seien die Aufkommens- und Verteilungswirkungen analysiert worden. Pläne wie eine Wohngeldreform oder ein höherer Mindestlohn habe man nicht berücksichtigt.








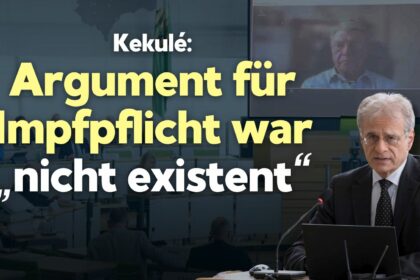























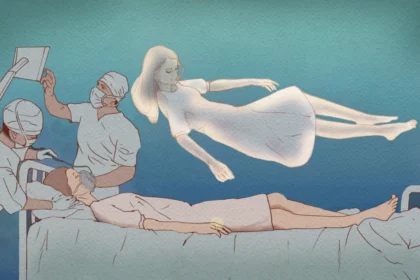
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion