
Wohnraum oder Eigentum – wo endet die staatliche Kontrolle?

In Kürze:
- Wohnraummangel und Leerstand: In vielen Städten fehlen Wohnungen, während gleichzeitig zahlreiche Einheiten leer stehen oder zu anderen Zwecken genutzt werden.
- Politische Gegenmaßnahmen: Kommunen reagieren mit Zweckentfremdungsverboten, Bußgeldern und Androhungen von Baugeboten, um Leerstand zu begrenzen und Wohnraum zu sichern.
- Kontroverse um Eingriffe: Kritiker warnen vor übermäßigen staatlichen Eingriffen bis hin zur Enteignung. Die Debatte dreht sich um das Spannungsfeld zwischen Wohnraumschutz und Eigentumsfreiheit.
In Hannover ist Wohnraum knapp. Nach einer Analyse des Pestel Instituts, über die unter anderem das Onlineportal „con-nect.de“ im vergangenen Jahr berichtete, müssten in Stadt und Region bis 2028 jährlich rund 5.420 Wohnungen neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken.
Zum Stichtag 15. Mai 2022 standen laut Zensus in der Landeshauptstadt 10.334 Wohnungen leer. Etwa 20 Prozent der Wohnungen in der Region Hannover blieben wegen laufender oder geplanter Baumaßnahmen ungenutzt. Rund 9 Prozent waren wegen eines anstehenden Verkaufs und weitere 9 Prozent, weil die Eigentümer sie künftig selbst nutzen wollten, unbewohnt. Bei etwa 3 Prozent war der Abriss oder Rückbau der Grund und für rund 20 Prozent wurden sonstige Gründe für den Leerstand genannt.
[etd-related posts=“5254632″]
Um den Leerstand zu begrenzen, gilt für die Stadt seit Juli 2025 eine Zweckentfremdungssatzung. Sie verbietet, die Wohnungen zweckzuentfremden. Dazu zählen eine Vermietung für Feriengäste, etwa über Airbnb, oder eine überwiegend gewerbliche Nutzung sowie ein langfristiger Leerstand. Ein Leerstand von mehr als sechs Monaten gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.
Nach Angaben der Stadt zielt die Satzung darauf ab, sicherzustellen, dass die Bevölkerung mit „ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen“ versorgt werden kann.
Kaum Bewegung auf dem Wohnungsmarkt
Ein Beispiel für wieder aktivierten Wohnraum in Hannover ist ein Häuserblock im Stadtteil Oberricklingen. Das kommunale Wohnungsunternehmen hanova sanierte dort 24 Dreizimmerwohnungen, die, nachdem sie entmietet wurden, über zwei Jahre lang leer standen. Seit Juli 2025 stehen diese Wohnungen nun Asylbewerbern zur Verfügung.
Die Fraktion Soziale Gerechtigkeit Hannover erkundigte sich im August 2024 in einer Ratsanfrage nach vermeidbaren Wohnungsleerständen bei hanova und der Stadtverwaltung. Laut der Antwort liegen der Verwaltung keine weiteren Fälle dieser Art vor.
[etd-related posts=“5248945″]
Andere Gebäude in Hannover bleiben allerdings weiter leer und auch bei großen Immobilien ist kaum Bewegung in Sicht. Laut dem „Lagebericht zur Stadtentwicklung 2024“ standen Ende 2023 in Hannover rund 225.000 Quadratmeter Bürofläche leer.
Eines dieser leer stehenden Gebäude ist das ehemalige E.ON-Verwaltungsgebäude im Stadtteil Mühlenberg, ein Bürokomplex aus den 1970er-Jahren. Nachdem das Unternehmen im März dieses Jahres nach Hannover Fischerhof gezogen war, steht der alte Gebäudekomplex leer. Nach Angaben der Stadt sei eine „Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe auf dem Grundstück wünschenswert“. Konkrete Pläne sind nicht bekannt.
Bundesweite Praxis: Ähnliche Regelungen in vielen Städten
Hannover steht mit seiner neuen Satzung nicht allein da. In mehreren deutschen Städten gelten bereits ähnliche Regelungen, die den Zweck von Wohnraum festlegen, nachdem ein Bundesgesetz von 2006 die Landesregierungen ermächtigt hat, eigene Regelungen zur Zweckentfremdung festzulegen.
In Berlin gilt ein Zweckentfremdungsverbot seit 2014. Es schreibt vor, dass Wohnraum nur mit Genehmigung zu anderen Zwecken genutzt werden darf. Dazu zählen etwa Vermietungen über Plattformen wie Airbnb oder die Nutzung als Büro.
Auch in anderen Städten wie München, Hamburg, Köln, Potsdam und Stuttgart wurden eigene Satzungen erlassen, die Leerstand und Ferienwohnungsnutzung begrenzen sollen. Sie unterscheiden sich im Detail, folgen aber demselben Prinzip: Wohnraum soll dem Mietmarkt erhalten bleiben.
Die Bußgelder bei Verstößen fallen unterschiedlich aus. Während Haus- oder Wohnungsbesitzer in Potsdam mit einer Strafe von bis zu 100.000 Euro rechnen und Eigentümer in Köln bis zu 50.000 Euro bezahlen müssen, würde ein Verstoß in Berlin und München mit bis zu 500.000 Euro zu Buche schlagen.
[etd-related posts=“5042032″]
Kurzzeitgäste nur für acht Wochen
Der Deutsche Ferienhausverband kritisiert in seiner Stellungnahme zum bayerischen Gesetz das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Die Regelung besagt, dass nur noch für acht Wochen oder nur noch ein Teil der Wohnung an Kurzzeitgäste vermietet werden darf.
Der Verband bemängelt, dass die Regelung zu pauschal sei und den wirtschaftlich bedeutenden Ferienwohnungsmarkt gefährde. Ferienwohnungen seien ein zentraler Bestandteil des bayerischen Tourismus, der jährlich Milliardenumsätze generiere und vorrangig von privaten Vermietern getragen werde. Ein Zweckentfremdungsverbot könne daher nur ein kleiner Beitrag zur Lösung der Wohnungsnot sein, da die Zahl der betroffenen Wohnungen im Verhältnis zum gesamten Wohnungsbestand gering sei.
Der Verband fordert, das Eigentumsrecht und den Bestandsschutz für bestehende Anbieter zu achten, Zweitwohnungen von Einschränkungen auszunehmen und Ausnahmeregelungen großzügiger zu gestalten. Insgesamt plädiert der Verband für einen Ausgleich zwischen dem Interesse an bezahlbarem Wohnraum und der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus.
Wohnungseigentümer können in vielen Fällen bei ihren lokalen Bezirksämtern einen Antrag auf eine Genehmigung der anderweitigen Nutzung von Wohnraum stellen. Dieser könnte genehmigt werden, wenn die Eigentümer ein schutzwürdiges öffentliches – wie eine Kindertagesstätte – oder ein privates Interesse – wie Mieteinnahmen für den Lebensunterhalt – nachweisen können.
Tübingen erwägt Bauzwang oder Enteignung
In Tübingen hat der parteilose Oberbürgermeister Boris Palmer schon 2019 eine weitergehende Maßnahme ins Spiel gebracht. „Wir haben nachgezählt: In Tübingen gibt es etwa 500 baureife Grundstücke. Es wäre Platz für etwa 2.000 Einwohner. Und im Schnitt liegen die schon 20 Jahre oder länger unbebaut herum“, sagte Palmer damals dem „Deutschlandfunk Kultur“.
Seine Forderung von damals:
„Es gibt dort im Baugesetzbuch einen Paragrafen mit der Nummer 176, der ganz klar sagt: Wenn in einer Stadt Wohnungsmangel festgestellt ist, das gilt für Tübingen, dann besteht die Möglichkeit, dass der Bürgermeister per Bescheid ein Baugebot erlässt. Das heißt: Es muss das gebaut werden, was auf dem Grundstück auf dem Bebauungsplan zulässig ist.“
Das teilte er damals auch den Eigentümern der Baugrundstücke mit. Diese sollten erklären, warum sie bisher ihre Grundstücke noch nicht bebaut hätten und ob sie in Zukunft bebauen oder verkaufen wollen, gern an die Stadt. „Und wenn sie sich weigern, wird ein solches Baugebot die Konsequenz sein“, so Palmer weiter.
„Wird ein Baugebot ignoriert, kann ein Bußgeld von 50.000 Euro erlassen werden. Spätestens dann werden die meisten bauen oder verkaufen. Wer dann immer noch uneinsichtig ist, muss auch mit einem Enteignungsverfahren rechnen.“
Diese Enteignungspraxis hat sich in Tübingen noch nicht durchgesetzt. Die Frage nach der tatsächlichen Zulässigkeit bleibt aber bestehen.
Sind Enteignungen zulässig?
Enteignungen sind in Deutschland grundsätzlich zulässig, aber nur unter engen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen. Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes erlaubt Enteignungen ausschließlich zum „Wohle der Allgemeinheit“, etwa für Infrastruktur, Wohnungsbau oder Stadtentwicklung – und nur, wenn sie gesetzlich geregelt sind und eine angemessene Entschädigung erfolgt.
Sie müssen, das stellten die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages 2019 klar, außerdem verhältnismäßig sein, also das mildeste geeignete Mittel darstellen, um ein öffentliches Ziel zu erreichen.
[etd-related posts=“5250882″]
Vergleich mit anderen Städten Europas
Auch in anderen europäischen Städten gibt es strikte Regeln, um Wohnraum vor Zweckentfremdung zu schützen. In Paris dürfen seit diesem Jahr Wohnungen höchstens 90 Tage im Jahr an Touristen vermietet werden. Vorher galt eine Grenze von 120 Tagen. In London liegt die Grenze ebenfalls bei 90 Tagen. Amsterdam erlaubt derzeit 30 Nächte, während Barcelona neue Lizenzen für Ferienwohnungen komplett ausgesetzt und die bestehenden streng kontrolliert hat. Diese Beispiele zeigen, dass viele Metropolen ähnliche Wege gehen, um den Druck auf ihre Wohnungsmärkte zu mindern, wenn auch mit teils sehr unterschiedlichen Ansätzen und Konsequenzen.
Wie wirksam sind solche Maßnahmen?
Ob solche Regelungen tatsächlich mehr Wohnraum schaffen, ist umstritten. Untersuchungen zum Berliner Zweckentfremdungsverbot kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus dem Jahr 2021 zeigte, dass das seit 2014 geltende Verbot von Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie Airbnb das Angebot solcher Wohnungen deutlich reduziert hat. Einige Einheiten seien dadurch wieder dem regulären Mietmarkt zugeführt worden. Dennoch habe die Maßnahme nur begrenzte Wirkung auf die allgemeine Wohnungsknappheit, da Ferienwohnungen nur einen Bruchteil des Gesamtbestands ausmachten.
Der Berliner Mieterverein (BMV) bewertete damals die Wirkung des Zweckentfremdungsverbots anders als das DIW. Während das Institut dem Gesetz zwar eine gewisse Wirkung zuschreibt, aber dessen Einfluss auf den Gesamtwohnungsmarkt für gering hält, betont der BMV, dass die Belastung in einzelnen Stadtteilen deutlich stärker sei.
Geschäftsführer Reiner Wild verwies darauf, dass der Rückgang von Ferienwohnungen vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sei und nicht auf das Gesetz selbst. In Bezirken wie Kreuzberg seien zeitweise mehr Ferien- als Mietwohnungen angeboten worden. Dort habe die Zweckentfremdung spürbare Auswirkungen auf die Mieten.
Der Mieterverein unterstützt daher die schon beschlossene Verschärfung der Regelung und die Registrierungspflicht für Anbieter, um Kontrollen zu erleichtern und Schlupflöcher zu schließen.
Eine Studie des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft untersuchte 2022, wie sich Regulierungen von Kurzzeitvermietungen wie das Berliner Zweckentfremdungsverbot auf den Wohnungsmarkt auswirken. Die Ökonomen bescheinigen einem Zweckentfremdungsverbot, dass dieses Wirkung zeige, aber nur begrenzt Wohnraum zurück auf den Markt bringe.
Demnach geben professionelle Airbnb-Vermieter nach einer Regulierung zwar einen Teil ihrer Objekte auf, im Schnitt kehren jedoch nur rund 60 Prozent der betroffenen Wohnungen in die Dauervermietung zurück. Der Rest bleibt leer, wird verkauft oder anderweitig genutzt.
Die Forscher sehen darin einen Hinweis darauf, dass solche Gesetze zwar den Druck auf den Kurzzeitvermietungsmarkt erhöhen, aber keine umfassende Entlastung für den angespannten Wohnungsmarkt schaffen.







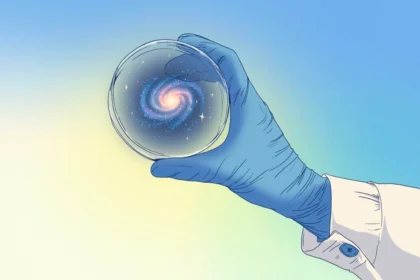
















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion