
Erbschaftsteuer: Was Deutschland von Schweden lernen kann

In Kürze:
- Söder (CSU) will Erbschaftsteuer regionalisieren, in Bayern mindestens halbieren – SPD und CDU lehnen ab
- Kritik: Steuerprivilegien für Großvermögen, Milliardenerben zahlen teils effektiv unter 1 Prozent
- Bundesverfassungsgericht prüft erneut Privilegien für Unternehmensvermögen, Entscheidungen 2025 erwartet
- Schweden hat Steuer 2004 abgeschafft; Lehre für Deutschland: Einheitssteuer oder Streichung
Markus Söder (CSU) will die Erbschaftsteuer auf den Kopf stellen: Jedes Bundesland soll künftig eigene Sätze festlegen dürfen – in Bayern würde der Ministerpräsident die Abgabe „mindestens halbieren“. Das sagte der CSU-Politiker am Montag, 1. September, gegenüber „Bild“: „Unser Ziel ist klar, die Steuer muss runter. Ein konkreter Vorschlag liegt auf dem Tisch: Wir regionalisieren die Erbschaftsteuer.“
Die SPD stellte sich sofort gegen den Söder-Vorstoß. „Das Letzte, was dieses Land jetzt braucht, ist ein Steuer-Dumping zwischen den Bundesländern, was die ohnehin schon kaputte Erbschaftsteuer angeht“, so SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf gegenüber „Bild“.
Ablehnung kommt nicht nur aus den Reihen der Sozialdemokraten. Auch CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz distanzierte sich: „Ganz ehrlich: Wir haben im Augenblick andere Sorgen, als uns mit steuerpolitischen Themen dieser Art zu beschäftigen. Ich sehe im Augenblick andere Prioritäten in der Steuerpolitik.“
[etd-related posts=“5233034″]
Einheitliche Regeln und alte Kritikpunkte
In Deutschland ist die Erbschaftsteuer bundesweit einheitlich geregelt. Wie viel Erben zahlen müssen, hängt vorwiegend vom Wert des Nachlasses und vom Verwandtschaftsgrad zum Verstorbenen ab. Ehepartner und Kinder profitieren von hohen Freibeträgen, während entferntere Verwandte oder Freunde deutlich stärker belastet werden. Zusätzlich gelten zahlreiche Sonderregeln, etwa für Betriebsvermögen: Wer ein geerbtes Unternehmen fortführt, kann die Steuerlast stark reduzieren oder sogar ganz vermeiden. Kritiker bemängeln seit Jahren, dass dadurch große Firmenerben geschont werden, während kleinere Nachlässe – etwa das Eigenheim – vergleichsweise stark ins Gewicht fallen.
Eine Auswertung des Netzwerks Steuergerechtigkeit aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass Personen mit einem hohen Vermögen stark von Steuerprivilegien profitierten. Zwar weist eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes vom Juli 2024 steigende Einnahmen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer aus, doch bei Großvermögen werden hohe Summen oft nachträglich erlassen. Laut dem Netzwerk „verzichtete“ der Staat im Jahr 2023 auf rund 2,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen, weil bei Großübertragungen von über 20 Millionen Euro ein Großteil der festgesetzten Steuer nachträglich erlassen wurde. Ferner zeigten die Statistiken, dass Milliardenerben teilweise „weniger als 1 Prozent Steuern“ auf die Nachlässe zahlten.
Karlsruhe beschäftigt sich erneut mit der Steuer
Die Erbschaftsteuer hat das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach beschäftigt. Im Jahr 1995 rügten die Richter erstmals die ungleiche Bewertung von Vermögen, 2006 erklärte Karlsruhe die Bevorzugung von Betriebsvermögen für verfassungswidrig. 2014 folgte ein weiteres wegweisendes Urteil: Die nahezu vollständigen Steuerbefreiungen für Unternehmensnachfolger seien zu großzügig und verletzten den Gleichheitsgrundsatz.
Der Gesetzgeber musste nachbessern und legte 2016 eine Reform vor, mit Obergrenzen, aber auch neuen Ausnahmeregeln. Seither wird immer wieder kritisiert, dass die Privilegien für Großvermögen weitgehend bestehen bleiben. Aktuell prüfen die Karlsruher Richter erneut, ob die geltenden Regeln mit der Verfassung vereinbar sind.
Insgesamt waren zu Jahresbeginn fünf Verfahren mit Bezug auf die Erbschaftsteuer bei den Verfassungsrichtern anhängig. Im Februar entschied das Gericht, dass zwei davon unzulässig seien. Eine inhaltliche Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit traf Karlsruhe nicht.
[etd-related posts=“4629764″]
Schweden: Abschaffung statt Reform
Wie gehen aber andere Länder mit der Versteuerung von Erbschaften um? Hier lohnt sich ein Blick in den Norden: Schweden hat die Steuer bereits vor fast zwei Jahrzehnten abgeschafft. Dort fließen heute keine Einnahmen mehr aus Erbschaften in den Staatshaushalt, und die politische Debatte ist weitgehend verstummt. Hat das Land damit einen klugen Schritt getan, und was bedeutet das für die deutsche Diskussion?
Im Oktober 2004 fasste der schwedische Reichstag einen bemerkenswerten Beschluss: Einstimmig votierten die Abgeordneten für die ersatzlose Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungsteuer. Zum 1. Januar 2005 war sie Geschichte. Dabei hatte es in Schweden die Steuer lange Zeit in sich. Im Jahr 1983 lag der Spitzensteuersatz laut Angaben des schwedischen Unternehmerverbands Svenskt Näringsliv bei 70 Prozent, höher als fast überall sonst in Europa. Und doch brachte sie kaum Geld: Weniger als 0,2 Prozent der gesamten Steuereinnahmen im Jahr 2004 stammten aus dieser Quelle. 1987 wurde der Höchstsatz auf 60 Prozent abgesenkt, 1992 auf 30 Prozent, bevor die Steuer dann 2004 ganz abgeschafft wurde.
Die Probleme waren vielfältig. Unternehmerfamilien kämpften mit komplizierten Bewertungsverfahren, die Liquidität für die Steuerzahlung war oft schwer aufzubringen. Wohlhabende Haushalte entwickelten aufwendige Modelle, um die Steuer zu umgehen, oder verlegten ihren Wohnsitz ins Ausland. Das Vertrauen in die Legitimität der Abgabe schwand.
Im offiziellen Abschlussbericht des Vermögensteuerausschusses des schwedischen Parlaments aus dem Juni 2004 hieß es, die Steuer bremse Unternehmertum und Wachstum, ohne einen nennenswerten Beitrag zum Staatshaushalt zu leisten. Die politische Konsequenz, die das Parlament damals zog: lieber streichen als weiterwursteln.
[etd-related posts=“5225997″]
Aus heutiger Sicht lässt sich klar sagen: Die Abschaffung hat Schweden nicht geschadet. Der Staatshaushalt brach nicht ein, die Steuer war schon zuvor unbedeutend. Aber: Wer nach einem klaren Beweis sucht, dass dadurch die Wirtschaft spürbar schneller gewachsen ist oder mehr Jobs entstanden sind, findet wenig Belastbares.
Die fiskalische Bedeutung der Erbschaftsteuer in Schweden war von Beginn an gering. Der schwedische Ökonom Daniel Waldenström schreibt in einem Beitrag für den „ifo DICE Report“ aus dem Jahr 2018 zur Erbschaftsteuer in Schweden:
Die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer betrugen im Nachkriegszeitraum etwa 0,1 Prozent des BIP, während die Vermögensteuer rund doppelt so viel einbrachte.“
Bewegung im schwedischen Finanzmarkt
Auch wenn Experten wie Waldenström die Auswirkungen der Abschaffung der Erbschaftsteuer auf die Wirtschaftskraft als gering erachten, ist die Bewegung auf dem schwedischen Finanzmarkt nicht zu übersehen. Laut einer 2025-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehörten die Renditen auf dem schwedischen Aktienmarkt zu den stärksten weltweit. Schweden hat zudem „die höchste Zahl börsennotierter Unternehmen in der EU“ und eine Marktkapitalisierung von 159 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Der Erfolg hat laut der OECD mehrere Gründe. Dazu gehören einfache und flexible Regeln für Anleger. Auffällig ist, dass viele kleine Firmen den Börsengang wagen. Das mittlere Volumen eines Börsengangs seit 2000 betrug 8 Millionen US-Dollar. Zudem gebe es eine ausgeprägte Aktienkultur: „Schwedische Haushalte haben einen der höchsten Beteiligungsgrade an Kapitalmärkten in Europa“, heißt es im Bericht weiter.
Die „Financial Times“ titelte im vergangenen Jahr: „Wie Schwedens Börse zum Neidobjekt Europas wurde“. In den vergangenen zehn Jahren seien in Schweden 501 Unternehmen an die Börse gegangen, mehr als in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Spanien zusammen.
[etd-related posts=“5179758″]
Folgen und Lehren für Deutschland
Die Lehre aus Schweden für Deutschland ist zweischneidig. Einerseits zeigt das Beispiel, dass man eine kaum ergiebige und hochkomplexe Steuer tatsächlich ersatzlos streichen kann – ohne wirtschaftliche Katastrophen. Andererseits bleibt der Hinweis, dass die Abschaffung allein keine Wunder bewirkt.
Für Deutschland bedeutet das: Entscheidend ist nicht das Ja oder Nein zur Erbschaftsteuer, sondern die Ausgestaltung. Ein einfaches, transparentes System wäre dringend nötig. So sieht es zumindest Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts.
In einem Aufsatz vom Januar dieses Jahres fordert das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung eine radikale Reform: einen einheitlichen Erbschaftsteuersatz von 5 bis 10 Prozent auf sämtliche Vermögenswerte, ohne Ausnahmen wie derzeit bei Betriebsvermögen. Außerdem sollen die Freibeträge dynamisch an Immobilien- und Vermögenspreissteigerungen angepasst werden. Ziel: mehr Transparenz, weniger Gestaltungsspielräume und eine gerechtere Verteilung der Steuerlast.
Ob Deutschland am Ende eine schlanke „Flat Tax“ (Einheitssteuer) ohne Ausnahmen einführt, wie es Fuest vorschlägt, oder eine moderate Reform mit weniger Schlupflöchern wagt – es ist eine politische Grundsatzentscheidung. Das Beispiel Schweden zeigt, dass auch die ersatzlose Abschaffung funktionieren kann, wenn die Steuer kaum Ertrag bringt. Klar ist nur: Ein verfassungsrechtlich unsicheres, bürokratisch schwerfälliges und gesellschaftlich umstrittenes Gesetz ist auf Dauer keine Lösung.






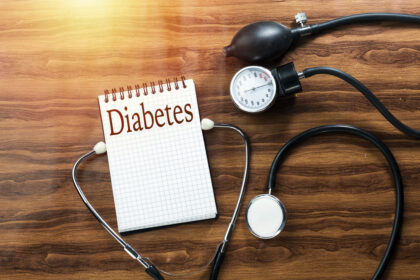








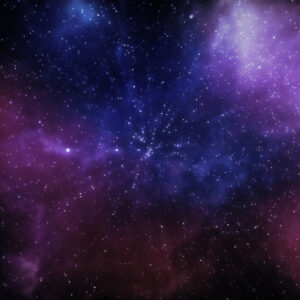









vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion