
Studie in der Kritik: 60.000 Staatsdiener zu viel – stimmt das?

Während in der Industrie die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr laut Bundesanstalt für Arbeit um 120.000 gesunken ist, steigt die Zahl der Beamten und Angestellten in der öffentlichen Verwaltung. Sie kosten den Staat immer mehr Geld. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kommt zu dem Schluss, dass es im öffentlichen Dienst 60.000 Stellen zu viel gebe.
Doch die Studie hat auch Schwächen, da sie mit Hochrechnungen arbeitet und – wie dort selbst eingeräumt wird – die Effizienz der offenbar zu vielen Stellen nur theoretisch mittels einer Formel berechnen kann.
Beamtenbund: Es fehlen 600.000 Beamte
Der Deutsche Beamtenbund (DBB) schlug am 11. August Alarm. Dem öffentlichen Dienst fehlen nach Angaben des Lobbyvereins der Beamten 600.000 Beschäftigte. Die größten Lücken gibt es laut DBB im Schulbereich, wo 115.000 Lehrer fehlen. In der Gesundheits- und Altenpflege würden 120.600 Personen mehr gebraucht und die Kommunalverwaltungen seien mit 108.500 Stellen unterbesetzt. Deshalb forderte der DBB-Bundesvorsitzende Volker Geyer die Politik auf, „neue Wege einzuschlagen“.
Richtig ist: Von der Sicherstellung der Kinderbetreuung – ab 2026 gilt der Anspruch auf Ganztagsbetreuung – über den Unterhalt von Krankenhäusern bis zu den gestiegenen Sozialhilfestellen und mehr erforderlicher Polizei müssen die Länder und Kommunen immer mehr Aufgaben bewältigen, die ihnen von der Bundespolitik zugemutet werden. In der Wahrnehmung der Länder und Gemeinden entstehen somit dramatische Engpässe – deshalb der Ruf nach weiteren Stellen.
[etd-related posts=“4918593″]
Studie: 3,4 Milliarden könnten eingespart werden
Und nun eine gegenteilige Erkenntnis: Das IW rechnet akribisch vor, wo auf Länder- und Kommunalebene Zehntausende Verwaltungsstellen zu viel besetzt seien. Der Fiskus könnte 3,4 Milliarden einsparen, so das IW. Das Institut wird finanziert von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und dem Bundesverband der Deutschen Industrie.
Im Zeitraum von 2013 bis 2023 sei die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland deutlich gestiegen, stellt die Studie fest. Vor allem auf kommunaler Ebene seien 330.000 Personen mehr eingestellt worden. Das entspricht einer Erhöhung von 24 Prozent. Auf Länderebene habe sich ein Plus von fast 12 Prozent herausgestellt. Das entspricht 275.000 Stellen mehr. Im Vergleich: Auf Bundesebene war lediglich ein Anstieg um 4 Prozent beziehungsweise 21.000 Dienststellen zu verzeichnen.
Diese Zahlen offenbarten
die erhebliche Relevanz von Ländern und Kommunen für den gesamten öffentlichen Sektor, denn über 80 Prozent aller öffentlich Beschäftigten sind dort tätig.“
Trotz dieser Entwicklung würden in vielen Bereichen weiterhin Personalengpässe beklagt. Allerdings würden diese Unterbesetzungen von den Gemeinden und Ländern rein zahlenmäßig wahrgenommen.
Ob die vermeintlich fehlenden Stellen auch wirklich zu einer Effizienzsteigerung führen würden, werde in den Überlegungen der Arbeitgeber der öffentlichen Hand vernachlässigt, bemängeln die Wirtschaftswissenschaftler. Regional zeige sich ein uneinheitliches Bild. Manche Kommunen bewältigten ihre Aufgaben mit geringem Personalzuwachs, andere hätten viel Personal eingestellt, ohne dass dies durch strukturelle Unterschiede zu den Vorjahren erklärt werden könne.
[etd-related posts=“4969261″]
Sachsen-Anhalt top, Schleswig-Holstein Schlusslicht
Der tatsächlich notwendige Personalbedarf wurde von den Wirtschaftswissenschaftlern mithilfe eines statistischen Modells ausgerechnet. Anhand des Modells könne man erkennen, wie sich die Zahl der Beschäftigten zwischen 2015 und 2022 „aufgrund von demografischen und sozialpolitischen Kennzahlen und wirtschaftlichen Faktoren hätte durchschnittlich entwickeln müssen“, wird in der Studie erklärt.
Demzufolge sei in Schleswig-Holstein die Beschäftigung im öffentlichen Dienst je Einwohner zwischen 2015 und 2022 mit 11,5 Prozent am stärksten gestiegen. Rein rechnerisch hätte ein Plus von 9,4 Prozent ausgereicht. Und so kommt die Studie zu dem Schluss, dass Schleswig-Holstein ein Einsparpotenzial von 3.600 Beschäftigten habe. Damit landet das nördlichste Bundesland im Vergleich zu allen anderen auf dem letzten Platz.
Spitzenreiter sei nach den Berechnungen des Wirtschaftsinstituts Sachsen-Anhalt. „Hier kamen das Land und die Kommunen mit zwei Prozent weniger Beschäftigung aus als prognostiziert“, heißt es in der Studie. Allerdings sei das Niveau der Beschäftigung gemessen an der Einwohnerzahl weiterhin sehr hoch. Auch Thüringen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Bayern seien mit weniger Bediensteten ausgekommen als angenommen. Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg seien aufgrund ihrer Besonderheit im querschnittlichen Bundesländervergleich nicht berücksichtigt worden.
[etd-related posts=“5222613″]
Starker Zuwachs in der Verwaltung
Besonders stark sei die Beschäftigung im Bereich „Politische Führung und zentrale Verwaltung“ mit mehr als 25 Prozent angestiegen. Die Studie vermutet, dass dies „möglicherweise politisch motiviert“ sei. Demgegenüber sei das Personal der Kommunen im Bereich Städtebau nur leicht aufgestockt worden, obwohl vielerorts Wohnraum knapp sei.
Auch einen „Zusammenhang mit dem hohen Bürokratieaufwand“ stellt die Studie her, der „vermehrt in der Wirtschaft als Belastung wahrgenommen“ werde. „Obwohl der öffentliche Dienst immer mehr Mitarbeiter beschäftigt, klagen Länder und Kommunen weiterhin über den Fachkräftemangel“, äußert der Studienautor Martin Beznoska in einer Pressemitteilung. Er fordert:
Die Analyse zeigt, dass einige Kommunen ihre Aufgaben mit deutlich weniger Personal bewältigen als andere. Statt ausschließlich über fehlendes Personal zu klagen, sollte sich der öffentliche Dienst vielmehr um effizientere Arbeitsweisen bemühen.“
Berechnung von Effizienz
Wie produktiv oder effizient ein Bediensteter im öffentlichen Dienst arbeitet, wurde von den Wirtschaftswissenschaftlern auf folgender Grundlage berechnet: „Effizienz öffentlicher Beschäftigung wird als Abweichung zwischen tatsächlicher und modellbasiert erwarteter Entwicklung gemessen“, heißt es in der Pressemitteilung.
Dies bezeichnet der Anglizismus „Benchmark“, also einen Vergleichsmaßstab. Grundlage dafür sei ein statistisches Modell mit Daten von 2015 bis 2022, das Veränderungen wie Wirtschaftslage, Zahl der Transferempfänger, Zahl der betreuten Kinder in Kindertagesstätten und Zahl der Schüler sowie deren Auswirkungen auf die öffentliche Beschäftigung berücksichtigt.
[etd-related posts=“5206109″]
„Diese Faktoren beeinflussen die Aufgaben der Kommunen und damit den Personalbedarf. Liegt der tatsächliche Personalzuwachs über dem erwarteten Wert, gilt er als ‚eher ineffizient‘, liegt er darunter, als ‚eher effizient‘“, erklärt das Institut seine Berechnungsmethode.
„Wäre die Beschäftigungsentwicklung in allen Flächenländern wie in Sachsen-Anhalt gewesen, wären knapp 60.000 VZÄ-Stellen [Vollzeitstellen] weniger bei Kommunen und Ländern entstanden“, heißt es im Fazit der Studie. Und weiter:
Nimmt man den durchschnittlichen Bruttojahresverdienst in der öffentlichen Verwaltung im Jahr 2024 an, so ergibt sich ein Einsparpotential von 3,4 Milliarden Euro im Jahr.“






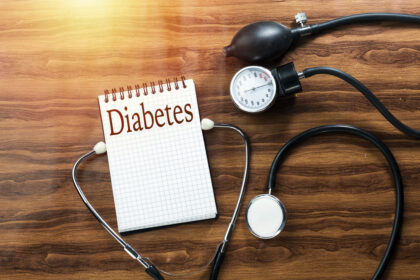








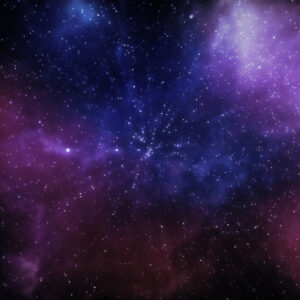









vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion