
Krebs: Nicht nur die Gene entscheiden

Krebs wird nicht mehr ausschließlich als genetisch bedingte Krankheit angesehen, sondern zunehmend als eine Erkrankung, die durch veränderbare Lebensstilfaktoren beeinflusst wird.
Ein Beitrag im Journal der American Cancer Society gibt an, dass schätzungsweise 40 Prozent aller Krebserkrankungen in den Vereinigten Staaten mit potenziell veränderbaren Risikofaktoren in Verbindung stehen, darunter Fettleibigkeit, schlechte Ernährung und Bewegungsmangel.
Die meisten Krebserkrankungen sind nicht erblich
Historisch gesehen wurde Krebs anhand der somatischen Mutationstheorie verstanden, die Theodor Boveri zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufstellte und die Chromosomenanomalien mit unkontrolliertem Zellwachstum in Verbindung brachte. Aufsehenerregende Fälle wie die präventive doppelte Mastektomie von Angelina Jolie im Jahr 2013, nachdem sie positiv auf eine BRCA1-Genmutation getestet worden war, verstärkten die Vorstellung, dass die Genetik das Krebsrisiko dominiert.
[etd-related posts=“4648492″]
Neueste Forschungsergebnisse haben jedoch gezeigt, dass erbliche Faktoren nur einen Teil der Krebsfälle ausmachen. Stattdessen spielt das Umfeld, in dem Gene wirken – beispielsweise geprägt durch Lebensgewohnheiten wie Rauchen, Ernährung und Übergewicht – eine weitaus größere Rolle.
Laut dem Bericht „Cancer Facts & Figures 2025” der American Cancer Society ist Zigarettenrauchen für die höchste Zahl an Krebstoten verantwortlich, was deutlich macht, dass viele Krebserkrankungen eher auf veränderbare Lebensgewohnheiten als auf vererbte genetische Faktoren zurückzuführen sind.
Fettleibigkeit: Adipositas erhöht das Krebsrisiko
Im Jahr 2002 identifizierte die Internationale Agentur für Krebsforschung Adipositas (Fettleibigkeit) als einen bedeutenden Risikofaktor für verschiedene Krebsarten, darunter Speiseröhren-, Darm-, Gebärmutter-, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Eine umfassende Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 zu Adipositas und Krebs untermauerte diesen Zusammenhang weiter und beleuchtet die Rolle von Fettleibigkeit bei zahlreichen Krebsarten. In Kombination mit einer ungesunden Ernährung wurde von den Forschern geschätzt, dass Adipositas für etwa 30 Prozent der Krebsfälle in den USA verantwortlich ist.
Adipositas trägt zur Entstehung von Krebs bei, indem sie ein biologisches Umfeld schafft, das das Tumorwachstum begünstigt – vor allem durch chronische Entzündungen, Hormonstörungen und Stoffwechselstörungen.
Dr. Jason Fung, Bestsellerautor von „The Cancer Code“, betont die zentrale Rolle von Insulin bei der Krebsentstehung. Das Hormon, das primär den Blutzuckerspiegel reguliert, kann bei erhöhten Werten als Wachstumsfaktor wirken und die Vermehrung verschiedener Zellen, einschließlich Krebszellen, fördern.
Übergewichtige oder fettleibige Menschen weisen tendenziell höhere Insulinspiegel auf, was unter anderem ein Faktor ist, der zur Entstehung von Brustkrebs beiträgt. Indem wir uns auf das metabolische und hormonelle Umfeld konzentrieren, in dem Krebs entsteht und uns gesund ernähren, können wir das Risiko laut Fung senken.
Krebs als Reaktion auf chronische Schäden
Schlechte Ernährung, Giftstoffe, Rauchen, chronische Entzündungen, Alterung oder andere Faktoren können chronische Zellschäden auslösen.
Laut Fung sollte sich die Hemmung von Krebs nicht nur auf die Ausrottung bösartiger Zellen konzentrieren, sondern auch auf die Wiederherstellung der zellulären Harmonie und die Verbesserung der biologischen Umgebung, die die Gesundheit erhält. Das Ziel ist es, den „Boden“ für das Wachstum von Krebs unbewohnbar zu machen.
Er schlägt Strategien vor wie:
- Chronische Entzündungen reduzieren: durch die Einschränkung von verarbeiteten Lebensmitteln, raffiniertem Zucker und übermäßigem Konsum von Omega-6-Fettsäuren bei gleichzeitiger Förderung entzündungshemmender Lebensmittel wie Gemüse, Omega-3-reichem Fisch und Olivenöl.
- Die Immunfunktion unterstützen: durch erholsamen Schlaf, regelmäßige körperliche Aktivität, nährstoffreiche Ernährung und die Minimierung von chronischem Stress. Fasten und Stoffwechseltherapien können helfen, den Insulin- und Glukosestoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen und so die Immunüberwachung wiederherzustellen.
- Stressbewältigung: Da anhaltende Stresshormone sowohl die Immunität als auch die Zellreparatur beeinträchtigen, können Stressreduktionspraktiken wie Meditation und Atemübungen hilfreich sein.
- Vermeidung von Giftstoffen, die Krebs erregen: Dazu gehören Tabak, Alkohol und Umweltgifte.
Die Rolle des Immunsystems
In den meisten Fällen erkennt und eliminiert das Immunsystem abnormale Zellen im Körper, bevor sie sich zu Krebszellen entwickeln können. Fung bezeichnet diesen fortlaufenden Prozess als „Krebsüberwachung“, die eine entscheidende Rolle dabei spielt, zu verhindern, dass Krebs zu einer nachweisbaren oder gefährlichen Krankheit heranwächst.
Wenn jedoch das Immunsystem geschwächt ist – durch chronische Krankheiten, Alterung, immunhemmende Medikamente oder andere Faktoren –, können Krebszellen der Überwachung durch das Immunsystem entgehen. Beispielsweise sind Organtransplantationspatienten einem dramatisch erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt. Diese Patienten erhalten oft hohe Dosen immunhemmender Medikamente, um eine Abstoßung des transplantierten Organs zu verhindern. Diese Medikamente tragen zwar zum Schutz des neuen Organs bei, schwächen jedoch auch die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers, einschließlich der Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören.
Fung weist darauf hin, dass Transplantationsprogramme aus diesem Grund so wachsam bei der Überwachung von Krebs sind, und führt ein Beispiel für dieses Phänomen bei einem Melanompatienten an. Der sichtbare Krebs war entfernt worden und der Patient schien sich in Remission zu befinden. Die Krebszellen blieben inaktiv und wurden vom Immunsystem unter Kontrolle gehalten. Jahre später verstarb die Person bei einem Unfall, und ihre Organe wurden gespendet. Bei einem der Empfänger entwickelte sich ein Melanom, da das Immunsystem zur Verhinderung einer Organabstoßung unterdrückt wurde und die Krebszellen nicht mehr unter Kontrolle gehalten wurden.
Fortschritte in der Immuntherapie
In den vergangenen Jahren konzentrierten sich Krebsbehandlungen wie Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie darauf, Tumore zu entfernen und Zellen abzutöten. Eine solche Behandlungsform kann zwar die Tumorgröße verringern, schädigt jedoch häufig auch gesundes Gewebe und bekämpft nicht die Ursache der Erkrankung.
Im Gegensatz dazu stellt die Immuntherapie einen transformativen Fortschritt dar, da sie auf die zugrunde liegende Funktionsstörung abzielt. Therapien wie die CAR-T-Zelltherapie nutzen die Immunzellen des Patienten und programmieren sie so um, dass sie Krebszellen erkennen und zerstören. Indem sie Krebszellen „enttarnen“ – die oft Mechanismen entwickeln, um der Erkennung durch das Immunsystem zu entgehen –, stärken diese Behandlungen die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers und stellen seine Fähigkeit wieder her, die Krankheit zu hemmen.
Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Cancer Is Not Just in Your Genes: Be Aware of These Key Culprits“. (deutsche Bearbeitung kr)







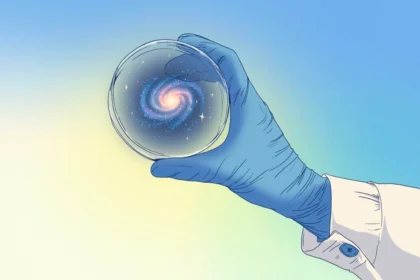
















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion