
Tektonische Verschiebung im Weltfinanzsystem: Schwäche des Dollar könnte geopolitische Gefahr darstellen

Der Dollar schwächelt, und das nicht zu knapp. Seit Jahresbeginn hat die US-Währung laut dem sogenannten Dollar-Index, der die US-Währung mit einem internationalen Devisenkorb vergleicht, über 9 Prozent eingebüßt.
Für die Anleger mag das wie eine übliche Schwankung aussehen, doch Experten sprechen inzwischen von der schlechtesten Bilanz seit Anfang der 2000er-Jahre. So fragte schon im April dieses Jahres die US-amerikanische Bank J.P. Morgan in ihrem Blog, ob die Sonderstellung der USA an den Finanzmärkten, der sogenannte US-Exzeptionalismus, gerade aufbricht.
Seit mehr als einem Jahrzehnt seien US-Aktien, Staatsanleihen und der Dollar die Stützen des globalen Finanzsystems gewesen, so die Banker. Nun kam es zum Jahresanfang erstmals seit Jahren zu einem gleichzeitigen Abverkauf aller drei Anlageklassen. Das deute auf ein schwindendes Vertrauen internationaler Investoren in die Marktführerschaft der USA hin und könnte eine Abwertung des Dollars um 10 bis 20 Prozent gegenüber Euro und Yen nach sich ziehen.
Die USA blieben zwar ein Kernmarkt, so die Banker von J.P. Morgan, doch die politische Unsicherheit, nachlassendes Wachstum und die Gefahr einer strukturellen Dollar-Schwäche machten eine stärkere Diversifizierung über Regionen, Währungen und Anlageklassen notwendig.
[etd-related posts=“5168041″]
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Bank of America. Wie das Finanzportal „Investing.com“ schreibt, erwartet die zweitgrößte US-Bank eine weitere Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Bis Ende dieses Jahres erwartet das Bankhaus für den Wechselkurs dann einen Stand von 1,17. Aktuell liegt der Wechselkurs bei etwa 1,1656 Euro zum Dollar – das heißt, 1 Euro entspricht ungefähr 1,1656 US-Dollar.
Das wäre eine Abwertung des Dollars bis Ende des Jahres um rund 0,4 Prozent – keine dramatische Zahl, wenn man draufschaut. Weiß man aber, dass der Kurs zu Jahresbeginn noch bei 1,0352 Euro zum Dollar lag, so ist der Dollar seit Jahresbeginn gegenüber dem Euro um etwa 12,59 Prozent abgewertet worden.
Doch hinter der aktuellen Kursentwicklung lauert ein weiteres Risiko, das bislang kaum im Mittelpunkt der Debatte stand: die massiven Bestände ausländischer Staaten an US-Staatsanleihen. Sollten große Gläubiger ihre Papiere in nennenswertem Umfang auf den Markt werfen, droht dem Dollar eine Abwärtsspirale, die durch klassische geldpolitische Instrumente kaum noch zu bremsen wäre.
Ein Markt von gigantischem Ausmaß
Das US-Finanzministerium veröffentlicht regelmäßig die sogenannten TIC-Daten (Treasury International Capital), die den Umfang der ausländischen Bestände an US-Staatsanleihen zeigen. Laut der Nachrichtenagentur „Reuters“ hielten Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten im Juni Anleihen im Wert von 9,1 Billionen US-Dollar.
Allein diese Zahl verdeutlicht: Der Markt für US-Anleihen, an sich der liquideste und sicherste der Welt, hängt in hohem Maße vom Vertrauen internationaler Investoren ab. Und die größten Halter sitzen keineswegs nur in China, wie häufig angenommen wird, sondern vor allem in klassischen Partnerstaaten der USA. Japan führt die Liste mit rund 1,1 Billionen Dollar an, gefolgt von Großbritannien mit mehr als 850 Milliarden Dollar. China (ohne Hongkong) rangiert mit offiziell rund 750 Milliarden Dollar auf Platz drei, doch dürften die „Schattenreserven“ weitaus höher sein.
Denn Peking lenkt über ein Netz von Fonds und Investmentgesellschaften Kapitalströme, stützt Märkte und kauft gezielt Beteiligungen. Dazu gehören auch die „vier goldenen Blumen“ – Offshore-Büros, über die die Devisenbehörde SAFE Teile der gewaltigen Währungsreserven verwaltet. Laut dem Finanzportal „finanzmarktwelt“ könnten diese „Schattenreserven“ bis zu 3 Billionen US-Dollar betragen.
[etd-related posts=“5165126″]
Rechnet man allerdings die Positionen befreundeter Staaten zusammen – von Japan, den NATO-Mitgliedern über die Cayman Islands bis hin zur Schweiz –, kommen diese Länder auf mehr als die Hälfte aller ausländischen Bestände. Mit anderen Worten: Nicht Peking allein, sondern die Partner in Europa und Asien halten den Schlüssel zur Stabilität des US-Anleihemarktes in ihren Händen.
Seit 2024 ist die Nachfrage nach US-Staatsanleihen insgesamt deutlich gestiegen. Vor allem große Investoren wie Japan und Großbritannien haben ihre Bestände auf Rekordniveaus ausgeweitet. Trotz einzelner Abflüsse verdeutlichen die Daten damit eine anhaltende Zunahme der Käufe.
US-Dollar: Vertrauen als Währungsfaktor
Warum investieren Verbündete so massiv in US-Staatsanleihen? Ökonom Barry Eichengreen von der University of California, Berkeley hat schon vor über zehn Jahren in seinem Buch „“ darauf hingewiesen, dass militärische Bündnisse und politische Allianzen die Nachfrage nach einer Währung erheblich steigern.
Das bedeutet: Staaten kaufen nicht nur amerikanische Anleihen, weil sie sicher und liquide erscheinen, sondern weil die politische Bindung an Washington das Risiko von Konflikten oder gar Enteignungen reduziert. „Wir stellen fest, dass Militärbündnisse den Anteil einer Währung an den Devisenreserven des Partners um 30 Prozentpunkte erhöhen“, schrieb Eichengreen in einer Studie für das wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitut National Bureau of Economic Research im Jahr 2017. Der Ökonom spricht in diesem Zusammenhang von der „geopolitischen Prämie“. Diese mache die USA seit Jahrzehnten zum bevorzugten Schuldner der Welt.
Doch dieses über Jahrzehnte gewachsene Vertrauen steht auf dem Spiel. Präsident Donald Trump hat in seiner zweiten Amtszeit einen Kurs eingeschlagen, der selbst enge Verbündete verunsichert. Mit Strafzöllen und Überlegungen zu schlechteren Konditionen für ausländische Gläubiger verunsichert Washington selbst enge Partner.
Hinzu kommt die Diskussion über einen möglichen „Mar-a-Lago-Akkord“. Die Idee stammt von Stephen Miran, seit März 2025 Vorsitzender des Council of Economic Advisers, des ökonomischen Beratungsgremiums des US-Präsidenten. Sie sieht vor, dass ausländische Investoren gezwungen werden könnten, US-Anleihen zu schlechteren Bedingungen zu halten. Solche Vorschläge senden das Signal, dass internationale Partner nicht mehr auf die gewohnte Verlässlichkeit bauen können. Die Folge: Zweifel wachsen, ob die USA noch der stabile Anker sind, der sie für die Finanzmärkte so lange waren.
Was passiert bei einem Abverkauf?
Schon bisherige Signale aus Washington haben zuletzt heftige Marktbewegungen ausgelöst. Anfang April proklamierte Trump den „Liberation Day“ und belegte zahlreiche Länder und Importgüter mit hohen Zöllen. Innerhalb von acht Handelstagen verlor der Dollar-Index über 4 Prozent. Die Renditen zehnjähriger US-Anleihen sprangen von 4,2 auf 4,5 Prozent – der größte Zinsanstieg in einem so kurzen Zeitraum seit 2022, ausgelöst nicht durch ökonomische Daten, sondern durch politische Entscheidungen.
Wenn solche Eskalationen Schule machen, könnten Partnerstaaten beginnen, ihre Bestände schrittweise zu reduzieren. Auch wenn das nicht in Form abrupter Verkäufe geschieht, sondern über Jahre hinweg, würde das den Markt erheblich belasten. Denn ein langsamer, aber stetiger Rückzug bedeutet dauerhaft höhere Finanzierungskosten für die USA und eine strukturelle Schwächung des Dollars.
Ein massiver Verkauf von US-Anleihen hätte zwei unmittelbare Effekte: Erstens würden die Kurse der Anleihen fallen und die Renditen steigen. Höhere Zinsen verteuern Investitionen und Konsum, bremsen die Konjunktur und schwächen gleichzeitig die Attraktivität des Dollars. Zweitens würde der Währungsverfall selbst verstärkt, weil internationale Anleger zusätzliche Absicherungen bräuchten oder ganz aus Dollar-Positionen fliehen könnten.
China als „Waffe“ – und die Rolle der Partner
Lange Zeit galt China als größter Risikofaktor für den US-Anleihemarkt. Die Vorstellung, Peking könnte in einem Konflikt seine Bestände als politische Waffe einsetzen, beschäftigt Analysten seit Jahren. Doch in der Praxis hat China bislang nie größere Mengen abrupt abgestoßen, wohl auch weil ein solches Vorgehen die eigenen Bestände massiv entwerten würde.
Viel unterschätzter ist die Gefahr vonseiten der Verbündeten. Addiert man nur ein Drittel ihrer Bestände, entspräche das Verkäufen im Volumen von mehr als 1,4 Billionen Dollar, also in etwa doppelt so viel wie das, was China offiziell hält. Anders als Peking könnten europäische Staaten oder Japan solche Schritte nicht als Drohgebärde einsetzen, sondern aus nüchterner Risikosteuerung: Wenn die politische Verlässlichkeit der USA sinkt, will man sich nicht übermäßig vom Dollar abhängig machen.
[etd-related posts=“4647858″]
Parallel dazu wächst der Druck von einer anderen Seite: den BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben ihre Zusammenarbeit zuletzt vertieft und neue Mitglieder aufgenommen, mit dem erklärten Ziel, die Dominanz des Dollars im Welthandel zurückzudrängen.
Handelsabkommen in nationalen Währungen, die verstärkte Nutzung des Renminbi im Rohstoffhandel und die Diskussion über eine gemeinsame digitale Leitwährung weisen in dieselbe Richtung. Für China und Russland ist diese Strategie ein Mittel, die Abhängigkeit von Washington und die Anfälligkeit gegenüber Sanktionen zu verringern.
Noch ist der Dollar als Reservewährung kaum zu ersetzen, doch je mehr Zweifel an der Stabilität und Berechenbarkeit der US-Politik entstehen, desto attraktiver wirken diese Alternativen. Damit wird die strukturelle Schwäche des Dollars von außen zusätzlich verstärkt.
Strukturelle Folgen für die Weltwirtschaft
Ein dauerhaft schwächerer Dollar wäre weit mehr als ein amerikanisches Problem. Für Europa und Asien würde er bedeuten, dass Exporte in die USA teurer werden, während Importe aus den Vereinigten Staaten billiger würden – ein Wettbewerbsnachteil für viele Industrien. Für Rohstoffmärkte, die traditionell in Dollar berechnet sind, könnte ein Strukturbruch die Preisbildung verändern. Und nicht zuletzt stünde die Rolle des Dollars als dominierende Reservewährung zur Debatte.
Sollten Investoren beginnen, in nennenswertem Umfang auf den Euro oder den chinesischen Renminbi auszuweichen, könnte das internationale Finanzsystem in Bewegung geraten. Schon kleine Verschiebungen in den globalen Devisenreserven haben Signalwirkung und verändern die Machtbalance zwischen Staaten.
[etd-related posts=“4723383″]
Die Schwäche des Dollars ist mehr als ein ökonomisches Zwischenspiel. Sie offenbart, wie eng Finanzmärkte und Geopolitik miteinander verflochten sind. Während Analysten über Zinsentscheidungen der US-Notenbank oder über Inflationsdaten debattieren, lauert im Hintergrund eine Gefahr, die größer sein könnte als jede makroökonomische Kennziffer: der Vertrauensverlust internationaler Partner in die Stabilität und Berechenbarkeit der Vereinigten Staaten.
Sollte dieser Prozess Fahrt aufnehmen, könnte das geopolitische Vertrauen, das den Dollar seit Jahrzehnten stützt, verschwinden. Das Ergebnis wäre ein strukturell schwächerer Dollar – mit tektonischen Folgen für die Weltwirtschaft.






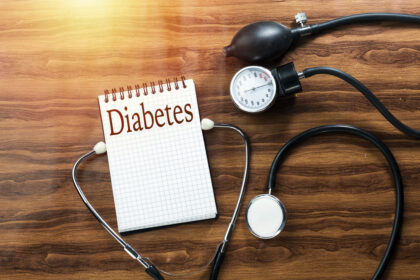



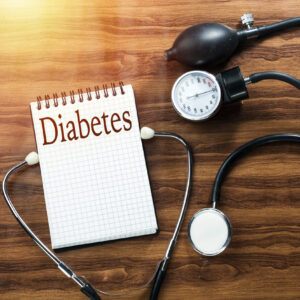














vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion