
Was passiert, wenn die Geldautomaten ausfallen?

Die Deutsche Bundesbank macht Ernst mit ihren Plänen für eine krisenresistente Bargeldversorgung. Die Entscheidung über die Ausschreibung der IT-Plattform für das Care-Projekt soll nach Angaben der Notenbank zeitnah durch den Vorstand getroffen werden, schreibt das Portal „Finanzbusiness“. Mit dem System möchte die Bundesbank künftig erstmals zentral Daten über die gesamte deutsche Bargeldinfrastruktur sammeln und in Krisenzeiten ein digitales Lagebild bereitstellen. Ziel ist es, dass Behörden und beteiligte Unternehmen in Echtzeit erkennen können, wo Bargeld verfügbar ist und wo Lücken bestehen.
Care, ausgeschrieben „Cash Resilience“, ist die praktische Umsetzung mehrjähriger Forschungsarbeiten zur Stabilität der Bargeldversorgung. Bereits im November 2022 erklärte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann, die neue IT-Anwendung solle ein jederzeit abrufbares Lagebild erzeugen, das in Not- und Krisenfällen entscheidend sein werde. Damit setzt die Bundesbank einen Plan um, der in enger Kooperation mit Wissenschaft, Banken, Wertdienstleistern und Handel entwickelt wurde.
Forschung zeigt Defizite im Bargeldkreislauf
Die Grundlage für Care bildet das Forschungsprojekt Basic, das zwischen 2020 und 2023 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Koordiniert vom brandenburgischen Institut für Gesellschaft und Sicherheit untersuchten Partner aus Wissenschaft, Banken, Wertdienstleistern und dem Handel, wie widerstandsfähig die deutsche Bargeldversorgung tatsächlich ist. Beteiligt waren unter anderem die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste, die Cash Logistik Security AG, die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services sowie als assoziierte Partner das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Commerzbank, die Bundesbank selbst und der Handelsverband Deutschland.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten deutlich, dass die größten Risiken nicht im Fehlen von Bargeldreserven liegen, sondern in der mangelhaften Abstimmung der Akteure. Zwar verfügen alle Beteiligten über eigene Krisen- und Notfallpläne, doch diese sind kaum miteinander verzahnt. In der Praxis weiß ein Akteur im Ernstfall oft nicht, wie sich die anderen verhalten werden. Basic beschrieb dies als Koordinationsdefizit, das im Krisenfall dazu führen kann, dass die Bargeldversorgung ausgerechnet dann ins Stocken gerät, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Care soll genau dieses Problem lösen, indem es alle relevanten Informationen bündelt und den Beteiligten ein gemeinsames Lagebild bietet.
Algorithmus und digitale Plattform für den Ernstfall
Parallel zu Basic entwickelte das Fraunhofer-Institut einen Optimierungsalgorithmus, der im Krisenfall berechnen kann, welche Geldautomaten und Filialen vorrangig beliefert oder mit Notstromaggregaten ausgestattet werden müssen. Damit soll eine faire Abdeckung der Bevölkerung mit Bargeld sichergestellt werden, auch wenn Personal oder Treibstoff für Geldtransporte knapp sind. „Es geht darum, die zentralen Bargeldbezugspunkte in Deutschland zu bestimmen“, erläuterte die Fraunhofer-Forscherin Laura Brouer schon 2023 auf der Website des Instituts.
Die Bundesbank will diese Erkenntnisse, so schreibt „Finanzbusiness“, in die Care-Plattform einbinden. Das geplante elektronische Verzeichnis soll nicht nur die Standorte von Filialen und Geldautomaten erfassen, sondern auch deren Funktionsstatus. Bislang fehlt eine solche Übersicht, da viele Automaten über keine Notstromversorgung verfügen und Ausfälle nicht melden können. Branchenexperten, wie beispielsweise das Brandenburgische Institut für Gesellschaft und Sicherheit, sprechen davon, dass der Staat bislang „blind“ sei, wenn es um die Lage im Bargeldkreislauf geht. Care soll dieses Defizit beheben und auf Knopfdruck zeigen, welche Standorte funktionieren und welche nicht.
Das Zusammenspiel von Care und Algorithmus wurde bereits in der bundesweiten Katastrophenschutzübung Lükex23 getestet. Dabei simulierten Bund und Länder einen großangelegten Cyberangriff auf das Regierungshandeln. Zum ersten Mal spielte die Bargeldversorgung bei einer Übung dieser Größenordnung eine eigenständige Rolle. Die Erfahrungen bestätigten, wie wichtig ein digitales Lagebild für schnelle Entscheidungen im Ernstfall ist.
Schwachstelle letzte Meile
Die Bundesbank betont, dass sie selbst für Krisen gut gerüstet sei. Jede der 31 Filialen halte Bargeldreserven vor, die ein Vielfaches des Tagesbedarfs abdecken. Außerdem sei ein Notbetrieb durch eigene Stromaggregate für mindestens 72 Stunden gewährleistet. „Bei uns liegt so viel Bargeld, so viel braucht kein Mensch“, sagte Beermann vor drei Jahren. Doch die eigentliche Herausforderung beginnt nicht in den Tresoren der Bundesbank, sondern auf der letzten Meile – dort, wo Bürgerinnen und Bürger Bargeld tatsächlich abheben.
Diese letzte Meile wird von Banken, Automatenbetreibern, Wertdienstleistern und dem Handel geprägt. Der deutsche Bargeldkreislauf ist stark fragmentiert, mit über 1.500 Kreditinstituten, zahlreichen Transportunternehmen und unabhängigen Automatenbetreibern. Diese Vielfalt bietet zwar eine gewisse Ausfallsicherheit, weil nicht alles von wenigen Akteuren abhängt; sie erschwert jedoch die Koordination erheblich. Verbindliche Informationswege fehlen, und die bestehenden Meldepflichten sind oft zu vertraulich, um allen Beteiligten zu helfen. Care soll dafür sorgen, dass im Krisenfall alle auf dieselbe Informationsbasis zugreifen können.
Politische Brisanz durch Energiekrise
Die Dringlichkeit des Projekts wird durch aktuelle Krisenszenarien zusätzlich verschärft. Viele Fachleute gehen davon aus, dass die meisten Institutionen auf Stromausfälle, die länger als einige Tage andauern, nicht ausreichend vorbereitet sind. „Das ist eine gravierende Schwachstelle in der Resilienzplanung“, erklärte Avi Schnurr, Vorsitzender des Electric Infrastructure Security Council – einer Denkfabrik, die Strategien zum Umgang mit solchen Risiken entwickelt, schon 2022 gegenüber den „Deutschen Wirtschaftsnachrichten“ (DWN). Besonders Banken sollten sicherstellen, dass sie auch während längerer Blackouts handlungsfähig bleiben. Dazu gehöre etwa, Vereinbarungen zu treffen, damit Transaktionen nachträglich erfasst werden können, sobald die Systeme wieder funktionsfähig sind, betont er. Schon die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 zeigte, wie schnell die Bargeldversorgung wegbrechen kann, wenn Bankgebäude zerstört und Automaten unbrauchbar werden.
Auch die Hurrikan-Katastrophe „Katrina“ in den USA vor knapp zwei Jahrzehnten gilt als mahnendes Beispiel. Damals waren es nicht Behörden, sondern Supermärkte wie Walmart, die die Grundversorgung sicherstellten – und das nur, weil die Kunden weiterhin bar zahlen konnten.
Mit der geplanten Ausschreibung für Care beginnt nun die praktische Umsetzung. Die Bundesbank ist überzeugt, dass das System nicht nur bei großflächigen Notlagen, sondern auch bei regionalen Störungen helfen wird. Entscheidend wird sein, ob Banken, Handel und Wertdienstleister bereit sind, ihre Daten einzuspeisen und Verantwortung zu teilen. Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt: Die größte Gefahr für die Bargeldversorgung liegt nicht in fehlenden Beständen, sondern in mangelnder Koordination.







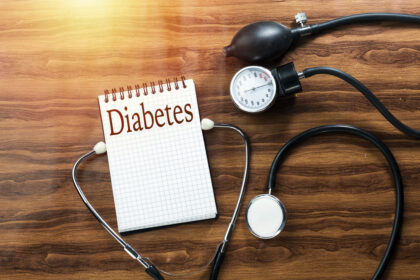


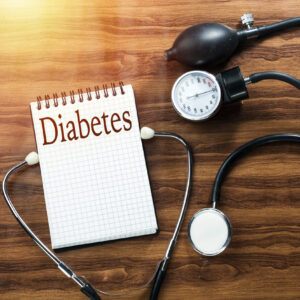














vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion