
Koalitionsvertrag macht Wohnen teurer: Das müssen Sie demnächst berücksichtigen

„Es wird teurer“ – mit diesen Worten kündigte der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz erst vor Kurzem im Politgespräch bei Miosga einen baldigen Preisanstieg beim Heizen an. Doch im Koalitionsvertrag von Union und SPD lauert eine weitere Neuregelung, die für Millionen Mieter und Immobilienbesitzer in Deutschland schon bald eine zusätzliche finanzielle Belastung bedeuten wird.
Die Rede ist von der Elementarschadenversicherung. Sie sichert eine Immobilie im Rahmen der Wohngebäudeversicherung verstärkt ab. Bisher sind diese beiden Versicherungsvarianten freiwillig. Laut Koalitionsvertrag sollen sie aber zu einem bisher nicht festgelegten Stichtag für alle Wohngebäude zur Pflicht werden.
Was steht im Koalitionsvertrag?
Union und SPD haben sich darauf geeinigt, dass Wohnneubauten künftig grundsätzlich eine „Wohngebäudeversicherung nur noch mit Elementarschadenabsicherung“ haben müssen. Bei Bestandsgebäuden sollen „sämtliche Wohngebäudeversicherungen zu einem Stichtag um eine Elementarschadenversicherung erweitert werden“.
Zudem planen die Koalitionsparteien, „eine staatliche Rückversicherung für Elementarschäden“ einzuführen sowie eine Regulierung der Versicherungsbedingungen. Ebenso soll eine Prüfung erfolgen, inwieweit die Bauplaner für ihre Arbeit in besonders schadensgefährdeten Gebieten besser zu schulen sind.
Überdies haben Union und SPD im Koalitionsvertrag darauf hingewiesen, im Zuge dieser Umstellung die Belange der Mieter im Blick zu haben. Wie das genau erfolgen soll, ist im Koalitionsvertrag nicht beschrieben. Für Mieter kann die Reform ebenso eine höhere finanzielle Belastung bedeuten, da die Vermieter die Mehrkosten voraussichtlich auf die Mieter umlegen werden.
[etd-related posts=“5102691″]
Wie verbreitet sind die Versicherungen?
Wohngebäudeversicherung
Die Wohngebäudeversicherung, also die Basisversicherung, ist im deutschen Wohnsektor bereits stark verbreitet. Der Vertragsbestand aus dem Jahr 2023 gibt „Statista“ mit rund 19,3 Millionen Verträgen an. Da der Gesamtbestand an Wohngebäuden hierzulande vor zwei Jahren bei rund 19,6 Millionen lag, ergibt sich eine Vertragsquote von 98,5 Prozent.
Obwohl die Wohngebäudeversicherung noch freiwillig ist, ist sie in vielen Fällen empfehlenswert. Kommt es zu einem Schaden, etwa durch Feuer, können hohe Kosten für eine Reparatur oder einen kompletten Wiederaufbau entstehen. Die Versicherung deckt dies ab.
Zudem setzen bestimmte vertragliche Verpflichtungen den Abschluss dieser Versicherung voraus. Wird eine Immobilie mit einem Kredit von der Bank finanziert, verlangt diese meist die Versicherung des Objektes, um eine bessere Sicherheit zu haben.
[etd-related posts=“5091332″]
Elementarschadenversicherung
Die Versicherungsdichte bei der erweiternden Elementarschadenversicherung ist dagegen schon deutlich dünner. Lediglich 54 Prozent der Wohngebäude in Deutschland sind gegen Elementarschäden durch etwa Hochwasser oder Erdbeben versichert. Für das Jahr 2023 entspräche dies rund 10,6 Millionen Wohngebäuden. Zusätzlich sind bundesweit aber weitere 9 Millionen Wohngebäude von der Neureglung durch Union und SPD betroffen. Ihre Besitzer müssen demnächst die Versicherung anpassen.
Dabei variiert die Versicherungsdichte stark nach Bundesland: Die mit Abstand höchste Versicherungsdichte mit 94 Prozent hatte Baden-Württemberg. Mehrere mitteldeutsche Bundesländer wie Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt haben Werte von um die 50 Prozent.
Am seltensten besitzen Wohngebäude in den nördlichen Bundesländern eine Elementarschadenversicherung. So lag 2023 die Quote hierfür in Bremen bei nur 31 Prozent, in Niedersachsen sind es 32 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern 33 Prozent.
Was decken die Versicherungen ab?
Die Gebäudeversicherungen decken verschiedene Fälle ab, die eine Wohnung oder ein Haus beschädigen oder zerstören. Das Versicherungsunternehmen kommt im Schadensfall für die Kosten auf, die sich oftmals im fünf- oder sechsstelligen Eurobereich befinden.
Die Wohngebäudeversicherung deckt Schäden ab, verursacht durch:
- Leitungswasser, beispielsweise durch einen Rohrbruch verursacht oder Frostschäden.
- Sturm ab Windstärke 8, einschließlich Hagelschlag.
- Feuer – dies beinhaltet Brand, Blitzschlag, Explosion und Implosion.
Die Elementarschadenversicherung deckt Schäden ab, verursacht durch:
- Hochwasser, Überschwemmung oder Wasserrückstau.
- Starkregen.
- Erdbeben, Erdrutsch oder Erdsenkung.
- Vulkanausbruch.
- Lawinen oder Schneedruck.
Wie viel kosten die Versicherungen?
Um zu ermitteln, wie teuer die geplante Neuregelung von Union und SPD für die Menschen wird, ist ein Blick auf die bestehenden Kosten für die Gebäudeversicherungen nötig. Die Preise variieren hier deutlich. Denn der Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Größe der Immobilie, der Wohnlage, der Gefahrenlage und der individuellen Leistung.
In der Regel beginnt der Versicherungsbeitrag für die Wohngebäudeversicherung ab 90 Euro pro Jahr.In manchen Städten wie Dresden, Potsdam oder Schwerin kann der Jahresbeitrag für ein Einfamilienhaus auch bei knapp 84 Euro liegen. Besitzer eines Einfamilienhauses mit 100 Quadratmetern zahlen laut dem Versicherer Cosmos Direkt normalerweise 200 bis 700 Euro pro Jahr. Für ein Mehrfamilienhaus fängt der Jahresbeitrag demnach erst bei rund 400 Euro an.
[etd-related posts=“5076859″]
Die Schadensursachen, die eine Elementarschadenversicherung abdeckt, kommen normalerweise seltener vor als die, die in die Basisversicherung fallen. Treten sie jedoch auf, kann der entstandene Schaden viel umfangreicher sein und die gesamte Immobilie zerstören. Daher fangen die Jahresbeiträge für eine Elementarschadenversicherung bei rund 200 Euro an. Mit einer optionalen Selbstbeteiligung von 500 Euro können sie aber auch bei 60 Euro beginnen.
Je nach Tarif kann die Selbstbeteiligung auch höher oder niedriger liegen. Je höher die Selbstbeteiligung, desto niedriger wird der Jahresbeitrag.Die Versicherer ordnen die Immobilie zur Beitragsbestimmung in eine von vier Gefährdungsklassen ein, je nachdem, wie häufig ein zerstörerisches Naturereignis auftritt.
Liegt ein größeres Haus in der Gefährdungsklasse 1 oder 2, was für eher selten auftretende Naturereignisse steht, kann der Beitrag laut der Volksbanken und Raiffeisenbanken bis zu 1.000 Euro pro Jahr betragen.
Rund 1,1 Prozent aller Immobilien in Deutschland fallen in die Gefährdungsklasse 3, wonach ein zerstörerisches Naturereignis einmal in 100 Jahren auftritt. Die Beiträge sind dann weitaus höher und der Versicherer kann als Bedingung für den Vertragsabschluss noch Umbaumaßnahmen am Gebäude fordern, falls erforderlich.
Welche Kosten kommen auf die Bürger zu?
Anhand der dargestellten Beträge müssen Immobilienbesitzer, die noch keine Gebäudeversicherung abgeschlossen haben, mit jährlichen Zusatzkosten von mindestens 300 Euro pro Immobilie rechnen – ohne Selbstbeteiligung. Bei ungünstigeren Bedingungen können die Zusatzkosten auch auf mehr als 1.000 Euro pro Jahr ansteigen.
Liegt ein Gebäude in der Gefährdungsklasse 4, „ist der Abschluss einer Elementarversicherung nur zu einem deutlich höheren Beitrag möglich. Nicht selten verweigern die Versicherer diesen Schutz“, so die Auskunftsseite der VR-Banken.
[etd-related posts=“5100358,5087716″]
Wie und wo wählt man die Gebäudeversicherungen aus?
Wie bereits erwähnt gibt es noch keinen festgelegten Stichtag, bis wann die Immobilienbesitzer die Gebäudeversicherungen abgeschlossen haben müssen. Wer schon jetzt wissen will, welche zusätzlichen Kosten genau bevorstehen, kann diese bei einem Vergleichsportal ermitteln. Hierfür kommen etwa Check24, Verivox oder Preisvergleich.de infrage.
Bei einer beispielhaften Eingabe eines Einfamilienhauses mit 100 Quadratmetern in Berlin mit Baujahr 1980 kostet eine Basis- und Elementarversicherung ohne Selbstbeteiligung mindestens 420 Euro pro Jahr.
Immobilienbesitzer, die bereits eine Wohngebäude- und Elementarversicherung abgeschlossen haben, betrifft die Neuregelung nicht.



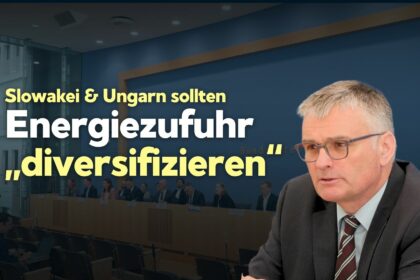
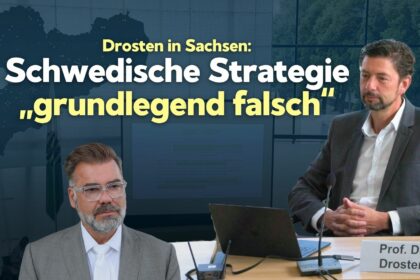

















vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion