„Das Agieren des Rechtsstaats unter Pandemiebedingungen“ hieß das Thema der Sitzung der Corona-Enquetekommission im Deutschen Bundestag am 3. November, die kontrovers verlief.
„Das schwedische Beispiel hat ja gezeigt, dass es da auch nicht mehr Tote gab“, sagte Professor Karl Albrecht Schachtschneider, der bei Gesundheitsfragen die Eigenverantwortung betonte.
Professor Rolf Rosenbrock sah bei den politischen Maßnahmen teilweise ein Problem bei der Fixierung auf Inzidenzwerte.
Rosenbrock, Professor für Public Health und Gesundheitspolitik: „Bei den Inzidenzen ist es das Problem, dass sie eigentlich nie repräsentativ waren, dass Sie nie wirklich wussten: Auf welche Teile der Bevölkerung treffen die Inzidenzwerte zu?"
Grundsätzlich seien sie jedoch besser als Mortalitätswerte. „Wir können nicht erst eingreifen, wenn die Leute tot sind."
Er plädierte ebenfalls für mehr Eigenverantwortung. „Den Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst in ihrem Umkreis die Vorschriften so auszulegen, so auszugestalten, dass es mit ihrer Lebenswelt, mit ihren Bedürfnissen besser übereinstimmt."
Die Obfrau der Grünen stellte sich die Frage, ob Ausgangsbeschränkungen prinzipiell mit der Demokratie vereinbar sind.
Paula Piechotta, Obfrau der Grünen in der Corona-Enquetekommission: „Und natürlich der Punkt, dass die wissenschaftliche Beratung der verschiedenen Regierungen in Deutschland nicht divers genug war, nicht genug unterschiedliche Perspektiven umfasste."
Diese müsse in zukünftigen Krisen besser und breiter aufgestellt werden. Auch die AfD-Abgeordnete Christine Baum sieht das ähnlich: „Ich habe immer wieder einen Runden Tisch gefordert. Das heißt also, auch kritische Wissenschaftler sollten mit einbezogen werden in die Beurteilungen.“
Laut dem Datenexperten Tom Lausen sei man bei den Lockdowns der chinesischen Regierung gefolgt. Der Sachverständige fragt: „Wie kommt es überhaupt dazu, dass man so einen Lockdown einfach so bereitwillig durchgezogen hat, wenn es doch überhaupt gar keine vernünftigen Daten dazu gab und auch keine Folgenabschätzung gemacht wurde?"
Professor Karsten Schneider, Rechtswissenschaftler an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: „Ich habe das in dem Eingangsstatement als das sichere Grundrechtsopfer bezeichnet. Wenn Sie einen Lockdown machen, dann schränken Sie offensichtlich sofort Freiheitsrechte ein. […] Die spannende und schwierige Frage in dem Zusammenhang ist der Wert des Lockdowns. Warum wird der eingeleitet?"
Die Verhältnismäßigkeit und die Folgen eines Lockdowns habe man in der Situation schon abgewogen. Für SPD-Politiker Daniel Rinkert war China kein Vorbild für die Maßnahmen während der Corona-Pandemie.
Rinkert: „Also China war, glaube ich, nicht die Handlungsmaxime der ehemaligen Bundesregierung und der Verantwortlichen, die damals entsprechend in den Parlamenten auch gehandelt haben, sondern immer die Frage: Wie können wir das Infektionsgeschehen eindämmen? Wie können wir Menschen davor schützen?"
Wir fragten ihn, was aus seiner Sicht in der Corona-Pandemie nicht gut funktioniert hat. „Was vielleicht nicht gut funktioniert hat, die Frage: Waren alle Maßnahmen gerechtfertigt? Haben wir auch alles gut erklärt? Haben wir auch alle Gruppen mitgenommen?" Anhand der Ausführungen der Sachverständigen sei für ihn deutlich geworden, „dass wir das zukünftig besser machen müssen."
Auch das Infektionsschutzgesetz war in der Sitzung mehrfach Thema. In der Corona-Zeit wurde es mehrfach geändert. Es soll helfen, übertragbare Krankheiten frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
Piechotta: „Das muss weiterentwickelt werden, damit wir in zukünftigen Krisen die Rechte von Menschen besser abwägen können gegen die gegebenenfalls dann wieder notwendigen Einschränkungen von Rechten.“
Auch Rinkert sieht einen „klaren Handlungsauftrag“, die Hinweise der Sachverständigen auszuwerten „und dann in eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes oder eben ein neues Pandemiebekämpfungsgesetz dann entsprechend hier im Bundestag auch zu erarbeiten.“
Schachtschneider hält das Gesetz gar für bedenklich. „Zum einen, weil da einfach die Pandemieerklärung der Weltgesundheitsorganisation zugrunde gelegt wird." Seiner Meinung nach müssten die zuständigen Organe alleine über Maßnahmen entscheiden.
Die Feststellung einer Epidemischen Lage von nationaler Tragweite könne aus seiner Sicht keine verfassungsrechtliche Grundlage für derart weitreichende Maßnahmen wie ein Lockdown sein. „Und da bin ich der Meinung, die Verfassungsgrundlage müsste eine Notstandsverfassung sein."
Dem widerspricht der von der CDU geladene Rechtswissenschaftler Schneider: „Wenn wir in unsicheren Zeiten sind, dann ist die Flexibilität des Verordnungsgebers durchaus etwas, was auch einen berechtigten verfassungsrechtlichen Platz ohne Notstandsverfassung hat."
Rosenbrock betonte hingegen, dass es in einer Pandemie wichtig sei Unsicherheiten und Risiken zu kommunizieren, „dass wir unter Unsicherheit handeln. […] Das hätte sehr viele Missverständnisse und sehr viel von den Spaltungen in der Gesellschaft verhindern können“.
In den Augen der AfD-Politikerin Baum hat der Rechtsstaat während der Corona-Pandemie größtenteils nicht funktioniert: „Denn die Gerichte sind ja diesen Empfehlungen des RKI gefolgt. Jetzt wissen wir durch die RKI-Protokolle, dass die ja politisch beeinflusst wurden."
Gerichte hätten Sachverhalte nicht eigenständig geprüft und könnten deswegen nicht zu einem anderen Ergebnis kommen.
Auch Professor Oliver Lepsius ging mit Regierungsentscheidungen härter ins Gericht. „Man kann also jetzt nicht sagen, wir wissen nichts und wir wussten nichts, und das Unwissen dann über drei Jahre als Rechtfertigungsgrund immer wieder aktivieren, das geht nicht.“
Er empfand einige Maßnahmen als übergriffig und sah als Ausgangspunkt dafür die Umstellung auf eine modelltheoretische Pandemiepolitik durch das Kanzleramt. „Und das war sicherlich eine strukturell falsche Entscheidung.“
In der nächsten Sitzung am 10. November soll über den Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen und den Umgang mit Langzeitfolgen beraten werden.



![[Live] Dobrindt: „Schlag gegen islamistische Polarisierung der Gesellschaft“](https://images-de.epochtimes.de/uploads/2025/11/Thumbnail-Dobrindt-zum-„Schlag-gegen-islamistische-Polarisierung-der-Gesellschaft.jpg)
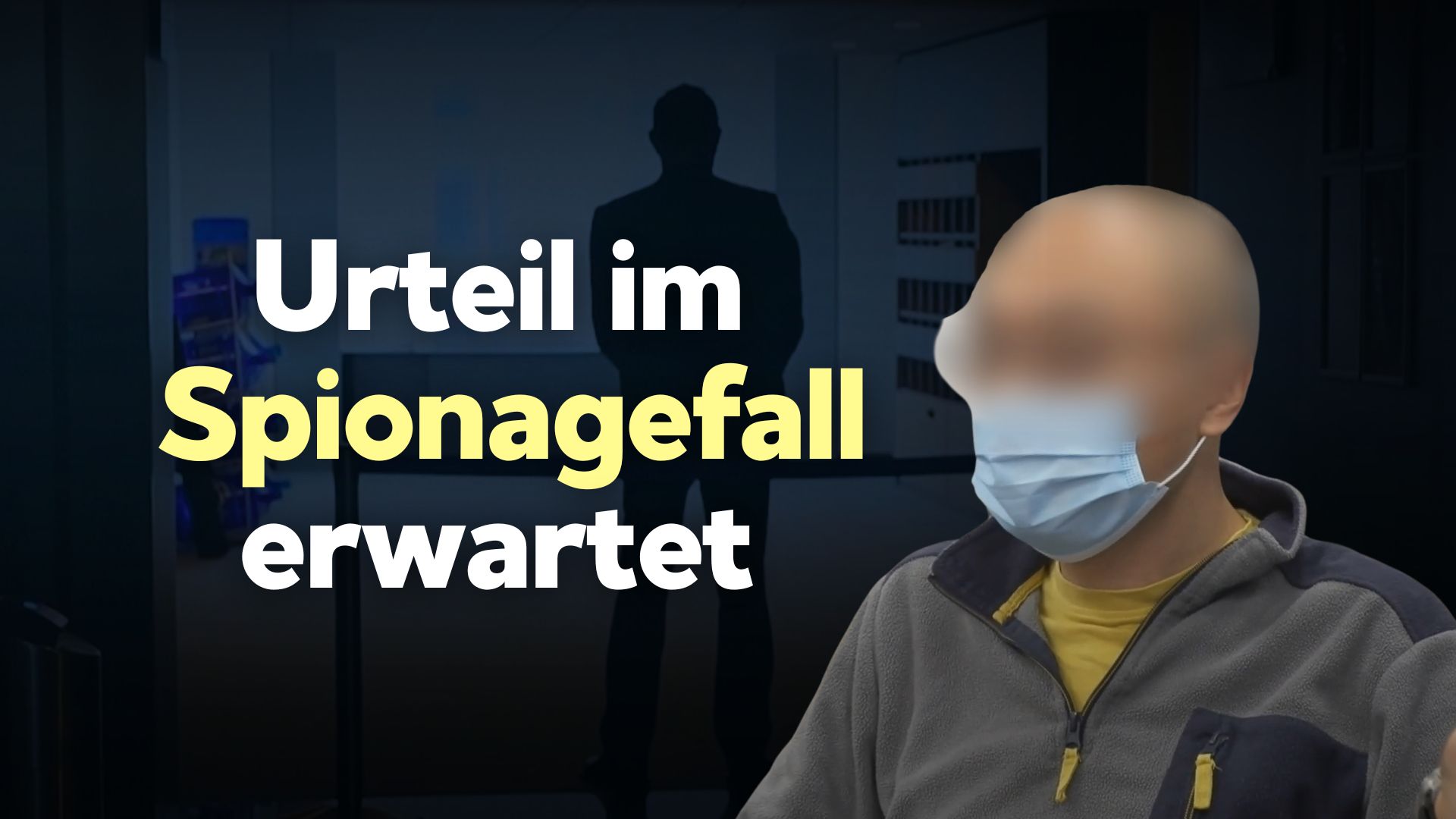




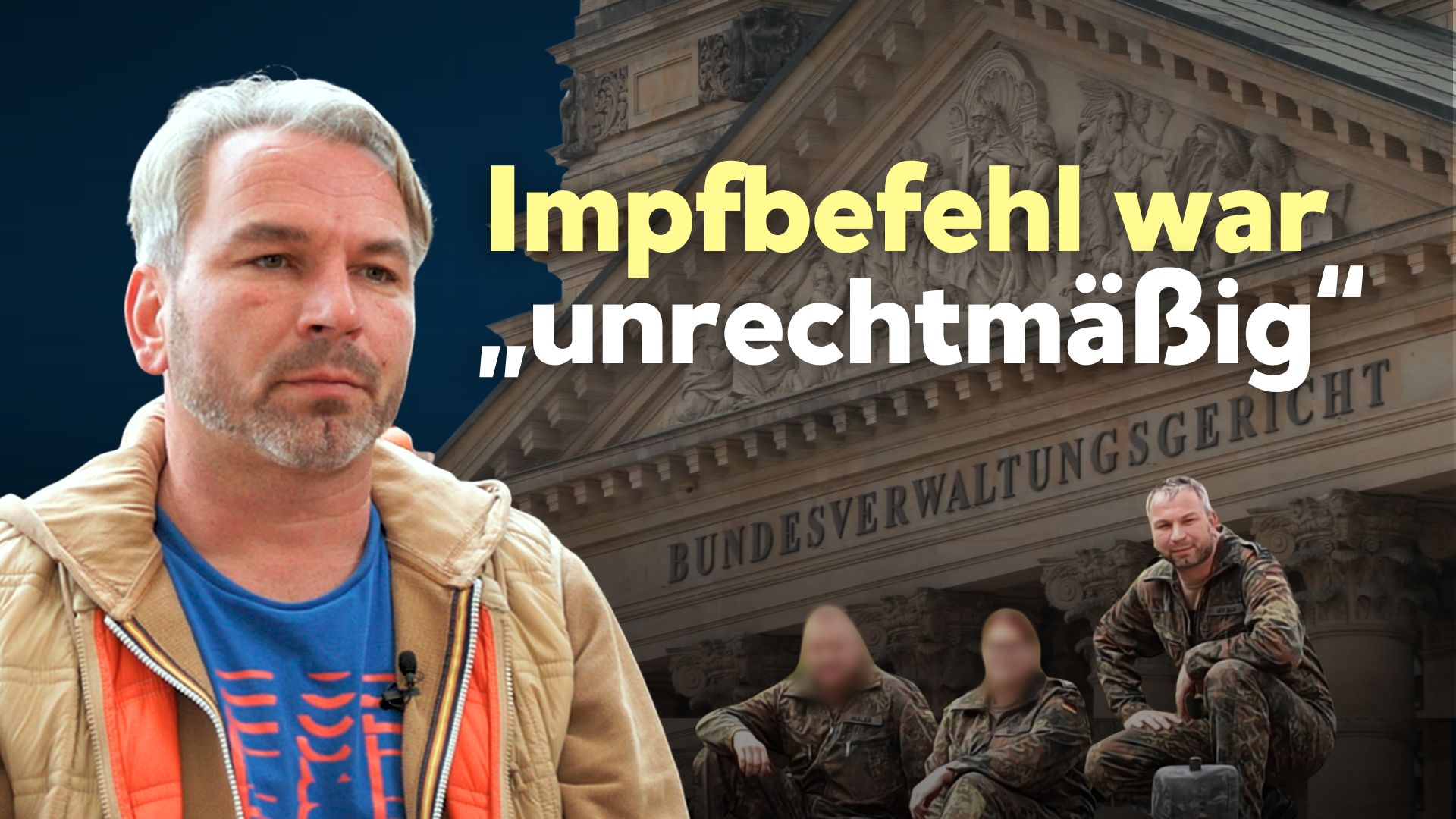

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion